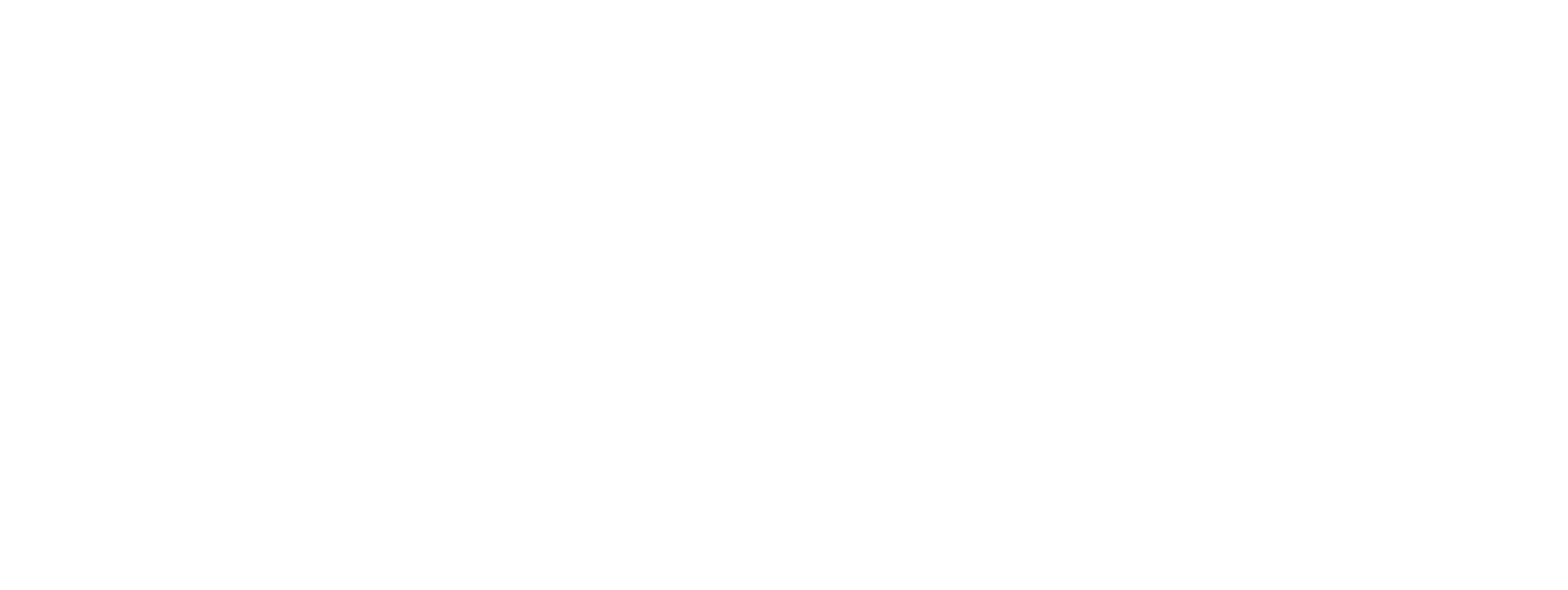Gründung BGB
Der Weg zur Parteigründung
Die Wurzeln der schweizerischen Bauernparteien, im Besonderen der bernischen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, liegen in der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung des ausgehenden 19. Jahrhunderts und den unmittelbaren Auswirkungen des Ersten Weltkrieges. Die Bundesverfassung von 1848 verschaffte den Bauern mit der Befreiung von Person und Boden, der Aufhebung der Binnenzölle und der Vereinheitlichung von Mass, Münze und Gewicht bedeutende Vorteile. Zudem brachten neue Erkenntnisse der Naturwissenschaften fruchtbringendere Wege des Anbaus. Die gesteigerten Erträge bei Getreide, Kartoffeln, Milch, Käse und Fleisch fanden guten Absatz und wurden noch nicht durch den Wettbewerb mit dem Ausland beeinträchtigt. Dank einem total revidierten eidgenössischen Grundgesetz von 1874 durfte die Landwirtschaft sogar mit staatlicher Förderung rechnen.
Diese günstigen Verhältnisse änderten sich aber im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts durch die aufkommenden Eisenbahnen und technischer Fortschritte. Die schweizerische Agrarwirtschaft geriet in den Einflussbereich des Weltmarktes. Die Einfuhr billigen Getreides aus Deutschland und den Oststaaten drückten die Preise und gefährdeten den einheimischen Kornanbau. So waren viele Bauern gezwungen, nachdem sie bereits mit der einsetzenden Industrialisierung teilweise vom Ackerbau auf Graswirtschaft hatten umstellen müssen, noch einseitiger auf die vorwiegend exportorientierte Vieh- und Milchwirtschaft zu setzen. Sie vermochten aber auch so die Krise nicht abzuwenden. All dies wirkte sich in mehrfacher Hinsicht verhängnisvoll aus. Der bäuerliche Anteil an der Gesamtbevölkerung ging zurück; um 1900 betrug er im Kanton Bern noch einen Zehntel der Einwohnerschaft.
Auch die sozialen Gräben wurden tiefer. Die Landwirtschaft befand sich nun auf einmal zwischen zwei Fronten: Auf der einen Seite war die im Freisinn verankerte, mächtig aufstrebende, Exportindustrie. Auf der andern stand die Arbeiterschaft, die in Gewerkschaften organisiert war und durch die 1886 gegründete Sozialdemokratische Partei gestärkt wurde. Deren Ziel war es, die Lebensmittelpreise möglichst tief zu halten. Daraus ergab sich für den Bauernstand – um zu überleben – immer drängender und fordernder die Notwendigkeit, sich zu organisieren und zusammenzuschliessen. Zahlreiche Berner Bauern, vorwiegend aus gehobenen Kreisen, waren damals Mitglieder der traditionsreichen Ökonomischen und Gemeinnützigen Gesellschaft OGG. Deren Tätigkeit beschränkte sich allerdings auf fachliche Bildung und Beratung. Wenn die Bauernschaft die schwere Zeit überstehen wollte, musste sie demnach auf andere Art vorgehen und zur Selbsthilfe greifen. So entstanden Ende der 70-er Jahre die ersten Landwirtschaftlichen Genossenschaften. Das waren berufliche Vereinigungen, die sich als hervorragender Unterbau der späteren Partei erweisen sollten. Sie erlebten einen raschen Aufschwung. 1889 schlossen sie sich zu einem kantonalen Verband zusammen, der unter der Leitung des Bauern und Nationalrats Johann Jenny stand und schon nach wenigen Jahren 253 Sektionen mit 25’000 Mitgliedern zählte.
Als sich um dieselbe Zeit auch in anderen Teilen der Schweiz ähnliche Bauernbünde bildeten, wagte man den Schritt auf die eidgenössische Ebene: Am 7 Juni 1897 gründeten 281 Delegierte im Berner Grossratssaal den Schweizerischen Bauernverband. Jenny wurde Präsident; Seele des Ganzen aber war der Sekretär, Prof. Dr. Ernst Laur, der durch seine jahrzehntelange, führende Rolle bekannt werden sollte. Die meisten Bauernparlamentarier gehörten noch der freisinnig- demokratischen Partei an. Doch die Bauern bekamen langsam das Gefühl, ihre Belange fänden nicht das nötige Verständnis. Auch glaubten sie sich in den Behörden untervertreten. Vor 1914 waren von den 32 Berner Nationalräten nur 4 Landwirte.
Der 1. Weltkrieg aber liess die Bauern sich ihrer staatserhaltenden politischen Schlüsselrolle bewusst werden. Auf ihnen lag die ganze Last der Versorgung. Das bedingte einen gewaltigen Arbeitseinsatz, bot wiederum aber auch Verdienst. Demgegenüber litten die Konsumenten zunehmend unter der Teuerung, was das Verhältnis zum Landvolk vergiftete.
Die Parteigründung
Unter solchen Umständen brauchte es wenig, um die 1913 von Jenny ausgesprochene Drohung, im Falle von „einseitiger bauernfeindlicher Bestrebungen“ eine eigene „landwirtschaftliche Partei zu gründen“, wahr zu machen. Der Funke zündete, als der Bundesrat 1917 die zu sogenannten „Bauerntagen“ aufgebotenen, durch harte Arbeit und Aktivdienst ermüdeten und gereizten Landwirte zu noch verstärkten Anstrengungen im Ackerbau aufforderte. Da wagten die Bauern in Zürich die entscheidende Tat und gründeten die erste Bauernpartei in der Schweiz. In den Grossratswahlen des gleichen Jahres 1917 errangen sie einen aufsehenserregenden Erfolg. Und damit war die Stunde Rudolf Mingers gekommen. Es begann mit der Rede am Aarberger Samenmarkt von November 1916 und ihrer Wiederholung in Büren an der Aare im Frühling 1917.
Noch sprach er nicht unmittelbar von einer Parteigründung, sondern vertraute weiterhin den bäuerlichen freisinnigen Führern und erhoffte sich eine Besserung der Zustände durch eine energischere Interessenvertretung seitens der einflussreichen bernischen Landwirtschaftsverbände. Aber er spürte, dass die Zeit für den erlösenden Schritt reif war und vor allem jüngere Landwirte nach mehr Standeseinfluss in den Behörden strebten. So „schlug“ er denn nur einige Monate später an der Delegiertenversammlung des Verbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften von Bern und anderer Kantone am 24. November 1917 in Bern „den Spunten aus dem Fass“ (So kommentierte Minger selbst dieses Ereignis): Er rief als Vorstandsmitglied am Schluss seiner berühmt gewordenen „Bierhübeli-Rede“ über „Die wirtschaftliche Lage unseres Landes mit besonderer Berücksichtigung der Landwirtschaft“ unvermutet zu einer politischen Neuordnung, zur Einführung des Proporzes und zur Gründung einer selbständigen Partei des bernischen Landvolkes auf. Er erntete begeisterten Beifall. Einstimmig beschlossen die Abgeordneten, die Vorstände der landwirtschaftlichen Verbände des Kantons zu einer gemeinsamen Sitzung aufzubieten.
Mingers Weckruf beflügelte. Bereits im Dezember 1917 versammelten sich der landwirtschaftliche Klub des Grossen Rates und die Vorstände der vier grössten genossenschaftlichen Verbände und ernannten eine 18-köpfige Kommission. Diese bestand aus Vertretern beruflicher und wirtschaftlicher Organisationen der Landwirtschaft und stand unter der Leitung von Nationalrat Jakob Freiburghaus, dem Präsidenten des Ökonomischen Vereins. Die Kommission hatte die Frage der Parteigründung zu prüfen. In den Sitzungen wurde entschieden, dass die künftige Partei nicht eine Wirtschaftspartei, sondern eine Mittelstandspartei werden sollte. Am 16. Juli 1918 stimmte eine Konferenz von Vertrauensmännern der landwirtschaftlichen Organisationen und des landwirtschaftlichen Klubs des Grossen Rates im Bürgerhaus zu Bern einhellig der Parteigründung zu, genehmigte die provisorischen Statuten und billigte das folgende Programm:
„Die Bernische Bauern- und Bürgerpartei erklärt sich als eine selbständige politische Vereinigung vaterländisch gesinnter Volksgenossen bereit, mit ihrer ganzen Kraft alle Bewegungen zu unterstützen, die darauf gerichtet sind, die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit unseres Landes und die geistige Selbständigkeit unseres Volkes zu wahren und zu stärken, die sittliche Grundlage, auf der unser Staatswesen fusst, unversehrt zu erhalten und auf dem Boden der bestehenden, das private Eigentum und den freien Wettbewerb schützenden Rechtsordnung, einen gerechten sozialen Ausgleich innerhalb der verschiedenen Volksschichten durchzuführen, unter entschlossener Zurückweisung aller kommunistischen Theorien und aller nicht durch gebieterische Staatsnotwendigkeiten bedingten Monopole. Diesen Richtlinien folgend, tritt die Partei ein für die Erhaltung eines schlagfertigen Volksheeres, unter unerbittlicher Bekämpfung aller in seinem Organismus zutage tretenden unschweizerischen Erscheinungen; für einen soliden, nach den Grundsätzen republikanischer Einfachheit geführten Staatshaushalt; für bessere Sicherung des Landes gegen drohende Überfremdung, vornehmlich durch wirksamen Schutz und zielbewusste Förderung der inländischen Produktion und Arbeit. Sie wird speziell allen Bestrebungen des Schweizerischen Bauernverbandes in dieser Richtung nachhaltige Unterstützung gewähren. Im Besonderen wird die Bernische Bauern- und Bürgerpartei die wirtschaftlichen, politischen und ideellen Interessen der Landwirtschaft und des gesamten arbeitenden Bürgerstandes des Kantons Bern nach innen und aussen wahrnehmen und zu diesem Zweck auf verbesserte Schul- und Berufsbildung unseres Landvolkes und Sicherung seiner wirtschaftlichen Zukunft, speziell auch auf eine zeitgemässe Besserung der Existenzbedingungen des landwirtschaftlichen Arbeitspersonals, hinarbeiten und sich die straffe Organisation und politische Aufklärung des Landvolkes auf kommunalem, kantonalem und eidgenössischem Boden zur Aufgabe machen.“ Dies war eine Proklamation, die sich nicht sehr von denen anderer bürgerlichen Parteien unterschied.
Am 28. September erklärte die erste Delegiertenversammlung in Bern offiziell die Parteigründung. Rudolf Minger, zum Präsidenten gewählt, verdeutlichte in seiner Rede seine Hauptanliegen. Ferner wurde ein Zentralvorstand von 40 Mitgliedern bestellt. Das erste politische Geschäft, das zur Sprache kam, war die Proporzinitiative für die Wahl des Nationalrats. Die Versammlung stimmte zu und das Schweizer wie das Berner Volk nahm sie am 13. Oktober, im vierten Anlauf, mit grosser Mehrheit an. Die neue Wahlart sollte sich in der Folge für die Partei überaus günstig auswirken. Ebenso vorteilhaft für sie war, dass der Landesstreik, ein von der sozialdemokratischen Führerschaft durchgeführter Massenaufstand, nach nur drei Tagen scheiterte. Kurz darauf erlebte die Bauern- und Bürgerpartei einen gewaltigen Mitgliederzuwachs. Als offizielles Parteiorgan wurde gemäss den ersten Statuten der „Schweizer Bauer“, das Blatt der Ökonomischen Gesellschaft, bezeichnet. Doch gründete man bereits 1919 die „Neue Berner Zeitung“, die schon 1922 eine Auflage von 12’000 Stück erreichte.
Schon bald fing die Partei an, nicht nur auf dem Papier zu existieren, sondern sie wurde aktiv und präsent im politischen Bereich. So wechselten am 11. März 1919 nicht weniger als 104 der 216 bernischen Grossräte das Lager, so zum Beispiel schon die aus der Parteigründungszeit bekannten Jenny oder Freiburghaus. Die nächste Folge ergab sich aus den eben angesprochenen, erstmals im Proporzverfahren durchgeführten Nationalratswahlen. 1921 fusionierte die Partei mit den Gewerbetreibenden. Das Interesse der Leute aus dem Gewerbe bestand schon lange, aber den letzten Anstoss dazu gaben die Vorbereitungen zu den Grossratswahlen von 1922. Der offizielle Name lautete nun „Bernische Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei“, BGB. Handwerk und Gewerbe hatten sich zu gleichberechtigten Partnern aufgeschwungen. Aus der Landpartei war eine Mittelstandspartei geworden.
Grossrat
Rudolf Minger wurde erst 1922 bernischer Grossrat. Aber bereits am 11. März 1919 wurde eine Grossratsfraktion der Bauern- und Bürgerpartei gegründet, wobei 104 von 216 Grossräten in das bäuerlich-bürgerliche Lager wechselten. Darunter waren auch die Freisinnigen Johann Jenny und Jakob Freiburghaus, welche bei der Parteigründung mitbeteiligt gewesen waren. Mit diesen 104 Mandaten hatte die Bauern- und Bürgerpartei auf einen Schlag die Mehrheit inne. Minger erhielt bei seiner Wahl 1922 diskussionslos den Posten des Präsidenten der BGB-Fraktion und behielt diesen bis zu seinem Austritt 1928.
Von 1922 bis 1925 war er Mitglied der Wahlprüfungskommission und 1927 der Kommission für das Tierseuchengesetz. Die Kommission zur Revision des Artikels 19 der Staatsverfassung im Jahre 1924 wurde von ihm präsidiert. Diese Kommission setzte sich für die Erhöhung der Wahlziffer für die Wahl des Grossen Rates ein. Dabei verwies Minger aber auch auf die dadurch entstehende Benachteiligung der ländlichen Bezirke. Die Initiative wurde trotzdem mit 104 gegen 89 Stimmen angenommen. Während seiner Amtszeit beschäftigten ihn die verschiedensten Themen. Am 12. September 1922 wurde Minger Mitglied in der Kommission für das Gesetz über die Beschaffung von Mitteln zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Dabei befürwortete er die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Arbeitsbeschaffung. Bei der Gesetzesvorlage über die Hilfeleistung an das Inselspital sprach er sich gegen eine Hilfe aus, die nach Zahl der Bevölkerung und nicht nach dem Steuerkapital bemessen werden sollte. Intensiv setzte Minger sich mit der Lötschbergbahn auseinander. Er verlangte die elektrische Beleuchtung im Lötschberg-Eisenbahntunnel, da ja auch der Gotthardtunnel neuerdings elektrisch beleuchtet sei. Dabei machte er nochmals auf die Wichtigkeit der Bahnen im Kanton Bern aufmerksam. Bei der Diskussion um die Vorlage, bei welcher der Staat Bern Wertpapiere der Kantonalbank zu deren Entlastung hätte übernehmen sollen, kam er nochmals auf die Bahnen zu sprechen und forderte Einsparungen im Staatshaushalt. Der Sozialdemokrat und Mingers erbitterter Gegner Robert Grimm griff ihn in dieser Debatte an und nannte ihn fortwährend Kavallerieoberst. Minger belehrte ihn, dass er zur Infanterie gehöre und nicht Oberst sei, sondern Oberstleutnant und im Übrigen habe er seinen Grad ehrlich abverdient: „Herr Grimm hat schliesslich seinen Grad als politischer Oberst auch redlich verdient, indem er ihn einen ganzen Sommer lang im schönen Simmental abverdienen musste.“ Nach dem Generalstreik 1918 verbüsste Grimm als Präsident des Oltener Aktionskomitees eine Freiheitsstrafe im Schloss Blankenburg.
Weitere Zusammenstösse mit anderen Parteien, die Minger stets mit Humor nahm, gab es zum Beispiel bei der Motion Gnägi über die Änderung des Artikels 33 der Staatsverfassung (Erhöhung der Mitgliederzahl im Regierungsrat von 3 auf 4) oder bei der Budgetdebatte am 22. November 1927. Die 216 Grossräte waren selten einer Meinung, so auch nicht bei der Verhandlung über einen Beitrag von 30'000 Franken an das Stadttheater. Minger wehrte sich dagegen und setzte sich ein weiteres Mal für die ländliche Gegend ein, die laut ihm einen solchen hohen Beitrag nicht verstehen würden. Die Städter verärgerte er damit. Bei der Behandlung des Gesetzes über den Warenhandel und Marktverkehr sprach er sich gegen die Verkürzung der Arbeitszeit aus, was von den Bauern erneut hätte falsch verstanden werden können. Bei ihrer Arbeitslage wäre keine Arbeitszeitkürzung möglich gewesen. Trotzdem unterlag Minger mit 78 gegen 79 Stimmen. Eingehend befasste er sich mit der Beteiligung des Kantons Bern am Bau der Oberhasliwerke. Er sah das Zukunftspotential in den Berner Kraftwerken und sprach sich am 11. März 1925 für eine Staatsanleihe aus.
Seine einzige im Grossen Rat eingereichte Motion beinhaltete eine Revision des bernischen Steuergesetzes, wonach das Existenzminimum zur Entlastung der kleinen Rentern und Witwen hätte erhöht werden sollen. Diese zog er aber am 14. September 1925 zurück, weil sie durch den ablehnenden bernischen Volksentscheid vom 28. Juli 1925 über die Revision des Steuergesetzes gegenstandslos geworden war.
Rudolf Mingers Tätigkeit im Grossen Rat war relativ bescheiden. Es wäre aber falsch, daraus zu schliessen, Minger habe für die Arbeit im Grossen Rat wenig Interesse aufgebracht. Er war für eine Arbeitsteilung, d.h. er war Parteipräsident, Fraktionspräsident im Grossen Rat und Mitglied im Nationalrat. Seine Möglichkeiten sah er vor allem auf dem eidgenössischen Parkett und nutzte diese, wie im Kapitel Nationalrat ersichtlich wird.
Nationalrat
Der 38-jährige Rudolf Minger wurde am 25. Oktober 1919 in den Nationalrat gewählt. Diese Wahlen fanden erstmals nach dem Proporzverfahren statt. Die Vorbereitungen liefen heiss, die Werbetrommeln wurden gerührt. Der 5. Oktober wurde zum wichtigsten Tag der Propaganda für die Nationalratswahlen. Im ganzen Kanton wurden gleichzeitig 22 Volksversammlungen veranstaltet und Reden gehalten. Insgesamt über 30'000 Leute versammelten sich an diesem schönen Herbsttag. Drei Wochen später, am 25. Oktober, fanden die Wahlen statt. Die Parteiführer rechneten mit 10, höchstens 11 Vertretern. Doch das Resultat der jungen Partei überraschte alle: Die Bauern- und Bürgerpartei errang 16 Mandate, das bedeutete die Hälfte der ganzen Berner Sitze. Die Sozialdemokraten erhielten 11, die Freisinnigen nur noch 5 Mandate.
Die Arbeit im Nationalrat beanspruchte Minger für mindestens drei Monate im Jahr, die Sitzungen in den Kommissionen nicht miteinberechnet. Trotzdem blieb er auf dem Hof in Schüpfen wohnhaft und holte sich die Hilfe eines Meisterknechts, der die Regie während seiner Abwesenheit übernahm.
Als Nationalrat gehörte Minger zwei ständigen Ratskommissionen an, seit 1919 der Geschäftsprüfungskommission und seit 1922 der Zolltarifkommission. Daneben war er im Lauf der 10 Jahre Mitglied von 33 nicht ständigen Kommissionen zur Vorberatung nationalrätlicher Geschäfte. Davon hat er fünf präsidiert, nämlich die Kommission für die „Entschädigung an die Inhaber von Interniertenanstalten“ (1921), für die „Zuteilung der Handelsabteilung zum Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement“ (1922), für die „Truppenordnung und Heeresorganisation“ (1924), für das „Abkommen für den Weltpostkongress in Stockholm“ (1925) und für die „Organisation des Landsturms“ (1928). Von besonderem Interesse für ihn war die Mitarbeit in den Kommissionen, für die er von Haus aus als Landwirt und Offizier Neigung und Sachkenntnis besass. So die Kommission zur „Entsumpfung der Rhoneebene bei Saillon“ (1920), die Kommission zur „Förderung des Getreidebaues“ (1922), die Kommission zur „Beratung des Berichtes des Bundesrates über Einfuhrbeschränkungen“ (1923), für die „Neue Getreideordnung“ (1929), für die „Erstellung von neuen Flugzeughallen für das Militärflugwesen“ (1923), für das „Handelsabkommen mit der Türkei“ (1927), für die „Handelsabkommen mit Frankreich“ (1928) und für das „Bundesgesetz über die Altersversicherung“ (1927).
Minger reichte im Nationalrat acht Motionen, Postulate und Interpellationen ein. Die zwei Motionen befassten sich mit der „Revision des Bundesratsbeschlusses über die Arbeitslosenunterstützung“ (1922) und mit dem „Buttereinfuhrmonopol“ (1927). Die drei Postulate Mingers betrafen die „Regelung der Fleischeinfuhr“ (1921), die „Verlegung der eidgenössischen Verwaltungen“ (1923) und das „Militärbudget“ (1924). In den drei Interpellationen setzte er sich mit der „Handhabung des Viehseuchengesetzes“ (1921), dem „Einfuhrverbot für Kartoffeln“ (1922) und dem „Benzinzollanteil der Kantone“ (1926) auseinander.
Landwirtschaftsfragen
Die Krisenjahre nach dem 1. Weltkrieg mit ihrer Arbeitslosigkeit und den sozialen Spannungen lasteten auf allen schwer. Der 1. Weltkrieg lehrte das Volk, dass die Landwirtschaft ein Grundpfeiler des Staates ist und dieser sollte geschützt und unterstützt werden. Der Bauer Rudolf Minger setzte sich in dieser schweren Zeit besonders dafür ein. Er sprach sich für eine Förderung der eigenen Landwirtschaft aus, bzw. für den Einfuhr-Stopp von Lebensmitteln, die selber produziert werden konnten. Für die Behebung der beginnenden Wirtschaftskrise sah er fünf Sofortmassnahmen vor: Die Käseausfuhr musste gefördert und die Buttereinfuhr beschränkt werden, der Getreidepreis sollte unverändert bleiben, die Schlachtviehpreise waren durch die Senkung der Einfuhr zu regeln und der Hackfruchtanbau war zu fördern. Nach Mingers Auffassung war die Ursache der Krise in der Landwirtschaft in den Lebensmittelpreisen zu suchen. Die Lebensmittel aus dem Ausland waren billiger als die eigenen, womit der Schweizer Bauer keine Chance mehr hatte, konkurrenzfähig zu sein. Minger verlangte für eine Verbesserung dieser Situation, dass die Politik der billigen Lebensmittelpreise aufgegeben werde. Diese sollten so angesetzt werden, dass die landwirtschaftliche Produktion rentiert. Dabei sollten die Lebensmittel aus der Schweizerproduktion gegenüber denjenigen aus dem Ausland bevorzugt werden.
Militärfragen
Auch das Militär hatte keine einfache Stellung. Nach dem 1. Weltkrieg lehnten die Sozialdemokraten die Armee ab und bekämpften die Wehrkredite. Minger bekannte sich von Anfang an zur Armee, in der er das Mittel zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Innern des Landes und zum Schutz der Unabhängigkeit und Neutralität anerkannte. Mit dieser Auffassung begab er sich in die Kampfarena mit den Sozialdemokraten. Sie verlangten die totale Abrüstung und vertrauten auf die Sicherheit durch den Völkerbund. 1924 stand die neue Truppenordnung nach Artikel 54 der Militärorganisation zur Beratung. Minger setzte sich dafür ein, dass das stellungspflichtige Alter wieder vom 20. auf das 19. Lebensjahr heruntergesetzt wird und die Wiederholungskurse für die Landwehr sollten wieder eingeführt werden. Diese momentane Situation sei nicht zeitgemäss und biete nicht den nötigen Schutz. Diese Einsparungen, die in der Nachkriegszeit gemacht wurden, schadeten dem Militär, denn so konnte es nicht mehr den Schutz der Neutralität gewährleisten, der nötig gewesen wäre. Minger forderte deshalb in seinem Postulat, das nötige Geld bereitzustellen, damit die Truppen wieder besser ausgerüstet werden konnten. Dem Antrag wurde stattgegeben, was einen Sieg für Minger gegen die Sozialdemokraten bedeutete. Am 19. Juni 1929 kam die neue Landsturmorganisation zur Sprache. Als Berichterstatter verwies Minger auf die Truppenordnung nach dem Bundesbeschluss von 1924. Danach war der Landsturm mit seinen 83 Bataillonen im Kriegsfall als erstes Aufgebot zur Bewachung von Bahnen, Brücken und Kraftwerken vorgesehen. Wegen des Bevölkerungsrückgangs waren nur noch 70 Landsturmbataillone möglich, dafür sollten diese mit Maschinengewehre ausgerüstet werden. Gleichzeitig wurde die Verbindung von Landsturm und Landwehr erwogen, indem Landsturmmänner den Spezialtruppen der Landwehr zugewiesen werden sollten. Auch dieser Bundesbeschluss wurde gutgeheissen und die Sozialdemokraten unterlagen ein weiteres Mal. So sagte Minger an die sozialdemokratische Adresse gerichtet: „Die Herren der Linken wollen auch die kleinste Gelegenheit nicht verpassen, um gegen die Armee zu demonstrieren.“
Der Nationalrat wählte Rudolf Minger für das Jahr 1927 zu seinem Vizepräsidenten und am 5. Dezember 1927 zu seinem Präsidenten für das Jahr 1928. Als Nationalratspräsident war Minger auch Präsident der Vereinigten Bundesversammlung.
Zwei Jahre später wurde er in den Bundesrat gewählt, wo er oft mit den gleichen Themen konfrontiert wurde wie im Nationalrat. Besonders der Kampf um die Armee ging weiter.
Bundesrat
Am 12. Dezember 1929 wurde der 48-jährige Rudolf Minger als Nachfolger des Berners Karl Scheurer in den Bundesrat gewählt. Er setzte sich mit hoher Stimmenzahl gegen den freisinnigen Kandidaten Hermann Schüpbach durch. Die Wahl des neuen Bundesrates fand schon im ersten Wahlgang bei einem absoluten Mehr von 117 mit 148 Stimmen statt. Seit der Gründung des eidgenössischen Bundesstaates zog somit der erste Bauer in den Bundesrat ein. Minger hatte sich als Nationalrat und besonders als dessen Präsident das Zutrauen der Bundesversammlung erworben. Mit Minger wurde für den abtretenden Haab ein weiterer Bundesrat gewählt: Dr. Albert Meyer.
Am Abend des folgenden Tages wurde der neu gewählte Bundesrat in Schüpfen empfangen. Dabei wurde der berühmte „Bundesrat-Minger-Marsch“ zum ersten Mal öffentlich gespielt. Diesen wunderschönen Empfang verdankte er mit folgenden Worten: „Nicht mir, sondern dem hohen Amt, in das man mich berufen, gilt der herzliche Empfang, den mir meine Mitbürger von Schüpfen bereitet haben und der mir ans Herz greift. [...] Ich bin nichts als ein Bauer, aber das bin ich.“ Diese Worte seien ihm zum Wahlspruch geworden.
Bei seinem Amtsantritt im Januar 1930 übernahm Minger das Militärdepartement und setzte damit die Tradition seiner beiden bernischen Amtsvorgänger – der Bundesräte Müller und Scheurer – die das gleiche Departement geführt hatten, fort. Als Oberst war Minger von Haus aus nicht nur Bauer, sondern auch Soldat. Das Departement war nicht sehr begehrt. Einer seiner Kollegen sagte zu ihm: „Diesen Posten wird Ihnen kein Bundesrat streitig machen. Sie werden noch etwas erleben“. Minger liess sich dadurch nicht einschüchtern.
Damals stand das Wehrwesen nicht hoch im Kurs. Die Erinnerung an den 1. Weltkrieg 1914 bis 1918 lastete nach wie vor auf den Völkern. Sie hatten nur den einen Wunsch: Nie wieder einen Krieg erleben zu müssen und bald einen dauerhaften Weltfrieden errichten zu können. Besonders die Sozialdemokraten vertrauten auf den Frieden und kämpften deshalb gegen die Schweizer Armee. Im Nationalrat wurde das Militärbudget von der Linken bekämpft und auch bürgerliche Ratsmitglieder machten mit oder enthielten sich bei Abstimmungen der Stimme. So wurden die jährlichen Militärkredite von 92 auf 85 Millionen herabgesetzt. Im Gegensatz zu den gesetzlichen Bestimmungen wurden zudem die Landwehr-Wiederholungskurse gekürzt – Mittel fehlten. Das war der Zustand, als Minger sein Amt antrat. Diese Entwicklung musste für die Aufrechterhaltung unserer bewaffneten Neutralität im Falle eines Krieges gefährlich werden. Dies erkannte er schon früh und setzte während seiner ganzen Amtszeit für die Schweizer Neutralität ein. So ein Wort von ihm:
„Weil alles so ist, ist mir nicht verständlich, wieso die sozialdemokratische Führerschaft in derartiger Schärfe unsere Wehreinrichtungen bekämpft und warum sie ausgerechnet in dem Momente, da die internationale Sicherheit gefährdet erscheint, sich in Gegensatz setzt zu massgebenden, einflussreichen Genossen des Auslandes, die die Notwendigkeit der Landesverteidigung einsehen. Ich kann meinerseits nicht daran glauben, dass unsere schweizerische Arbeiterschaft gewillt ist, einmal unser Land wehrlos der Willkür, der Gnade oder Ungnade der Grossmächte auszuliefern. Da können die sozialdemokratischen Führer hier im Ratssaal sagen, was sie wollen. Ich bin fest überzeugt, dass, wenn unsere Arbeiterschaft aufgeklärt ist, sie ihren Führern die Heerfolge auf dem Wege zur Abrüstung verweigern wird. Weil das so ist, glaube ich auch, dass die schweizerische Sozialdemokratische Partei einmal dazu kommen muss, sich auf den Boden der Landesverteidigung zu stellen.“
So sollte es auch sein, aber erst ab 1936. Mit seinem Amtsantritt begann er mit dem systematischen Wiederaufbau unserer Landesverteidigung. Zunächst musste er dem Vorwurf der Geldverschleuderung für das Militärwesen entgegentreten. Zu diesem Zweck setzte er im Frühling 1930 die „Ersparniskommission für die eidgenössische Militärverwaltung“ ein. Sie hatte zu untersuchen, ob beim Militärwesen, ohne Beeinträchtigung der Wehrkraft unserer Armee, Einsparungen gemacht werden könnten, und ob es insbesondere möglich sei, die Militärausgaben auf jährlich 85 Millionen zu beschränken. Die Kommission leistete gründliche Arbeit und leuchtete in alle Abteilungen des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD). Sie prüfte die Einsparungsmöglichkeiten in Kursen und Schulen, in der Materialbeschaffung und in der ausserdienstlichen Tätigkeit der militärischen Landesverbände. Nach dreijähriger Arbeit kam sie zur Überzeugung, dass wesentliche Einsparungen nicht gemacht werden konnten, ohne die Landesverteidigung ernsthaft zu gefährden. Sie befürwortete nicht einen Abbau, sondern einen Aufbau und Neubau des Wehrwesens.
Inzwischen waren die internationalen Abrüstungsgespräche in Genf ergebnislos verlaufen und das Scheitern der Konferenz gab das Signal zu einer allgemeinen Aufrüstung der Völker. 1933 legte man den eidgenössischen Räten ein Kreditbegehren von 15 Millionen zur Auffüllung der erschöpften Materialreserven vor. Wieder traf er auf sozialdemokratischen Widerstand, welchem er mit einer Offensive entgegentrat. Er wandte sich ans Volk und zwar an die Arbeiter. In Gränichen im Aargau kam es im Oktober 1930 zu einer ersten Begegnung Mingers mit der Arbeiterschaft. Er gewann damit bei den Arbeitern deutlich an Boden und konnte den Arbeiterführern im Nationalrat beweisen, dass das Volk nicht ganz ihrer Meinung war. Ähnliche Reden folgten später an verschiedenen Orten. Der Höhepunkt seiner Aufklärungstätigkeit über die Armee wurde seine berühmte Rede vom 9. Juli 1933 im Amphitheater in Windisch bei Brugg, wo vaterländische Verbände einen Tag der Jugend einberufen hatten. Es gelang Minger, die rund 20’000 Teilnehmer zählende Volksversammlung von der Notwendigkeit neuer Militärausgaben zu überzeugen, und er fand die Zustimmung für seine Forderung eines 100-Millionenkredites für die Aufrüstung der Armee. Dieser Kredit setzte sich aus 18 Millionen, die bereits früher bewilligt worden waren, und 82 Millionen für Kriegsmaterial (Vermehrung der Zahl der Maschinengewehre, Anschaffung von Minenwerfern und Infanteriekanonen, Umbewaffnung der Gebirgsartillerie und Anschaffung von Flugzeugen) zusammen. Profitieren davon sollte vor allem der Grenzschutz.
Der Tag von Windisch brachte einen klaren Umschwung in der schweizerischen Wehrbereitschaft und im Wehrwillen. Nun kamen auch die eidgenössischen Räte nicht mehr darum herum, die 100 Millionen für die Aufrüstung der Armee zu bewilligen. In der Septembersession der eidgenössischen Räte von 1934 wurde die neue Wehrvorlage, die als wichtige Neuerung die Verlängerung der Rekrutenschule auf drei Monate, enthielt, angenommen. Zudem wurde 1936 die neue Truppenordnung verabschiedet. Sie brachte eine vollständige Neugliederung der Armee und des Grenzschutzes mit den Grenzschutzkompanien und den „Leichten Truppen“. Damit war der Anfang zur ununterbrochenen militärischen Bewachung unserer Landesgrenzen gemacht.
Für den weiteren Ausbau unseres Wehrwesens und der Landesverteidigung war auch die Wandlung innerhalb der sozialdemokratischen Partei von Bedeutung. Ab 1936 begannen die Sozialdemokraten die Notwendigkeit der Landesverteidigung zu erkennen, nachdem ihnen die Entwicklungen in Berlin, Rom und Wien die Augen geöffnet hatten. Die Hoffnung, den Frieden zu erhalten, schwand und die Kriegsgefahr wuchs. Sollte der Schweiz der Frieden erhalten bleiben, dann musste sie genügend gerüstet sein. Als der 100-Millionen-Kredit des Jahres 1933 aufgezehrt und weitere 250 Millionen nötig waren zur Durchführung des umfangreichen Reorganisationsprogramms, beschlossen Bundesrat und eidgenössische Räte 1936 eine Wehranleihe in der Höhe von 235 Millionen aufzulegen, die vom Volk um 100 Millionen überzeichnet wurde.
Die Mittel der Wehranleihe gestatteten die moderne Bewaffnung der Armee. Die Verteidigungswerke an den Landesgrenzen wurden vermehrt und die Zahl der Grenzschutzkompanien erhöht. Diese wichtige Etappe in der Landesverteidigung konnte 1937 abgeschlossen werden. Minger legte besondern Wert darauf, in seinen Reden immer wieder zu betonen, dass er die Aufrüstung der Armee als willkommene Massnahme zur Bekämpfung der Krise betrachte.
Im Jahre 1938 wurde die allgemeine Wehrpflicht auf das 60. Altersjahr ausgedehnt und durch das Bundesgesetz vom 3. Februar die Dauer der Rekrutenschule von drei auf vier Monate verlängert. Auch die Ausbildung der Unteroffiziere und Offiziere wurde gleichzeitig neu geordnet, damit die Armee die neuen Waffen richtig gebrauchen lernte.
Rücktritt
Am 8. November 1940 reichte Bundesrat Minger beim Nationalratspräsidenten sein Rücktrittsgesuch ein. dieses trug folgenden Wortlaut:
„Hochgeehrter Herr Nationalratspräsident!
Bei meinem Eintritt in den Bundesrat am 1. Januar 1930 fasste ich den festen Vorsatz, dem eidgenossischen Militärdepartement nicht länger als höchstens zehn Jahre als Chef vorzustehen. Für die Durchführung dieses Entschlusses traf ich im Sommer 1939 die entsprechenden Vorbereitungen. Der Ausbruch des europäischen Krieges im Herbst des letzten Jahres und die dadurch geschaffene Unsicherheit für unser Land machten es mir zur Pflicht, einstweilen noch in meinem Amte zu verbleiben.
Der Abschluss des Waffenstillstandsvertrages zwischen unsern Nachbarstaaten und die seitherige Entwicklung der internationalen Verhältnisse haben für die Schweiz eine militärische Entspannung gebracht, die es mir erlaubt, auf meinen frühern Entschluss zurückzukommen. Zudem stellen sich auf dem Gebiete der Politik und Wirtschaft für unser Land neue Probleme von grösster Tragweite. Für deren Lösung bedarf es neuer, unverbrauchter Kräfte.
Diese Überlegungen veranlassen mich, auf Ende dieses Jahres als Mitglied des Bundesrates zurückzutreten. Mit der Bekanntgabe meines Rücktrittes verbinde ich den Dank an die eidgenossischen Räte für das mir während meiner elfjährigen Amtstätigkeit geschenkte Vertrauen.
Genehmigen Sie, Herr Nationalratspräsident, die Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung. R. Minger, Bundesrat.“
In der Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung vom 10. Dezember 1940 wurden die beiden Bundesräte Baumann und Minger verabschiedet und der Berner Eduard von Steiger und der St. Galler Karl Kobelt als ihre Nachfolger gewählt. Minger verliess den Bundesrat im Alter von 59 Jahren zu einem Zeitpunkt, wo ihn das Schweizer Volk gerne noch weiter in der obersten Landesbehörde gesehen hätte. Vielen erschien sein Rücktritt als ein Rätsel. Es gibt mehrere Gründe, die seinen Rücktritt vermuten lassen. Schon bei seinem Amtsantritt 1930 hatte er sich dazu geäussert, nicht länger als zehn Jahre im Bundesrat zu bleiben. Diese Zehnjahresintervalle spielten in Mingers Leben eine wichtige Rolle. So wurde er 1909 in die landwirtschaftliche Genossenschaft gewählt, in den Nationalrat 1919 und in den Bundesrat 1929. Wenn er ein Jahr länger blieb, so begründete er dies damit, dass der Ausbruch des 2. Weltkrieges ihn daran hinderte, den Posten zu verlassen. Der Tod Hermann Obrechts, der Chef des Volkswirtschaftsdepartements und enger Freund Mingers, bewog ihn ebenfalls, ein Jahr länger zu bleiben. In tagebuchartigen Aufzeichnungen Mingers findet sich eine zusammenfassende Darstellung der Gründe seines Rücktritts. Daraus geht hervor, dass er sich gewünscht hätte, noch ein paar Jahre als Chef eines selbständigen Landwirtschaftsdepartements im Amt zu bleiben. Erst nach dem Scheitern dieses Projekts entschied er sich zum Rücktritt. Ausserdem sagte er einmal zu seinem Enkel: „Als ich in den Bundesrat gewählt wurde, erklärte ich, 10 Jahre bleibe ich im Amt, und wegen des Ausbruchs des 2. Weltkrieges im Herbst 1939 wurden es 11 Jahre“. Weiter sagte er auch: „Wollte ich unserem General auch weiterhin mit voller geistiger Unterstützung helfen, das eine Ziel, die Freiheit unseres Vaterlandes mit allen nur möglichen Mitteln zu verteidigen, blieb mir nichts anderes übrig, als sämtliche amtliche Verpflichtungen zu quittieren.“ Nicht alle im Bundesrat verstanden damals unter Verteidigung der Schweiz dasselbe.
Im Ganzen genommen war Mingers Tätigkeit als Bundesrat und als Chef des Militärdepartements für die Schweiz von wichtiger Bedeutung. Man muss sich ernstlich fragen, was geschehen wäre, wenn Minger die Schweizer Armee nicht so frühzeitig aufgebaut hätte. Bei seinem Rücktritt genoss er in allen Volkskreisen grosse Popularität, was ihm einen aktiven und schönen Lebensabend bescherte. Er erinnert uns stark an einen römischen Feldherrn, der in Zeiten des Krieges und Gefahr als Feldherr dem Land grosse Dienste geleistet hat und welcher nach erfüllter Aufgabe, wie Minger, wieder zum Pflug zurückkehrte. Aber der Berner Bauer-Bundesrat tat dies gern:
„Nun erfolgte mein Rücktritt nicht etwa, um dem Müssiggang zu frönen. Ich habe ganz einfach den Herrenrock ausgezogen und wieder die Bauernkutte angezogen. Jetzt bin ich wieder, was ich früher war: ein einfacher Bauer, und es ist mir wohl dabei.“
Reden
Rudolf Minger war während seines ganzen Lebens ein ausserordentlich reger Redner. Häufigste und beliebteste Orte für seine Auftritte waren öffentliche Grossveranstaltungen, vor allem die sogenannten „Volkstage“, „Vaterländische Versammlungen“ usw., ordentliche und ausserordentliche Partei- und Fraktionsanlässe, ferner – bedingt durch seine Tätigkeit als Chef des Eidgenössischen Militärdepartement – verschiedene militärische oder paramilitärische Veranstaltungen wie Manöver- und Kursbesprechungen, Inspektionen, Einweihungen, Amtseinsetzungen, Rücktritt- und Trauerfeiern, Versammlungen von Offiziersgesellschaften. Im weiteren sprach Minger natürlich häufig vor landwirtschaftlichen Verbänden, Genossenschaften usw., sowie bei verschiedensten gesellschaftlichen Anlässen, wie zum Beispiel bei Schützen- und Hornusserfesten, 1. August-Feiern, Sportveranstaltungen und in der Oekonomischen und Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Bern (OGG). Ausserdem sind die Referate, die Minger im Grossen Rat, Nationalrat und als Bundesrat zu den verschiedensten Themen hielt, zu erwähnen.
Zu Mingers Art und Weise, zu referieren: Die meisten Reden waren handschriftlich geschrieben, ein kleiner Teil wurde mit der Maschine getippt. Er formulierte die meisten Manuskripte vollständig aus, wobei er aber bei der tatsächlichen Rede oft vom Manuskript abwich. Er liebte es, in seinem breiten Berndeutsch zu sprechen, nur an ganz offiziellen Anlässen wählte er die hochdeutsche Sprache. Seine erste Rede hielt Rudolf Minger 1897 im Anschluss an seine Konfirmation vor versammelter Gemeinde. Diese tönte so:
„Geliebter Herr Pfarrer! In diesem wichtigen Augenblick, wo Sie uns die Erlaubnis zum Genusse des Heiligen Abendmahls erteilen, geziemt es sich, dass wir Ihnen unseren Dank vor der versammelten Gemeinde öffentlich bezeugen. Sie haben uns mit stetem Fleiss und geistiger Wärme in den Lehren des Heils unterrichtet, und die Pflichten gegen Gott und unsere Nächsten zu Gemüte geführt, bei unsern Schwächen immer gütige Nachsicht walten lassen. So wolle den Gott, dass wir Ihre Lehren im Herzen bewahren und uns durch untadelhaften Wandel Ihres Eifers würdig zeigen. Ihr wirklicher Vergelter aber sei unser aller Vater im Himmel. Er erhalte Sie und alle die Ihrigen in seiner Gnade, in Frieden und stetem Wohlbefinden. Er wolle Ihnen zudem einst beilegen die Krone der Gerechtigkeit und Sie beglücken mit allen Seligen in seinem Schosse. Amen.“
Mingers Aufstieg zum begehrtesten Redner dieser Zeit begann nicht mit einem politischen Amt, sondern innerhalb der landwirtschaftlichen Genossenschaft. In derjenigen von Schüpfen übernahm er 1909 den Vorsitz und 1911 wählte man ihn auch in den Vorstand des bernischen Genossenschaftsverbandes. In diesen Kreisen zog man ihn nun öfters als Redner heran. Am Anfang behandelte er rein wirtschaftliche Themen. Ins Gebiet der Parteipolitik wagte sich Minger mit seiner Rede am Aarberger Samenmarkt vom 13. November 1916, die er anfangs 1917 in Büren an der Aare wiederholte. Diese Rede wurde vom Volk begeistert aufgenommen und er vergrösserte damit seinen Bekanntheitsgrad.
Den absoluten Durchbruch schaffte Minger mit seiner am 24. November 1917 gehaltenen „Bierhübeli-Rede“, welche er vor 512 Delegierten des bernischen Genossenschaftsverbandes hielt. In der Bierhübelirede sprach er zuerst von der inländischen Lebensmittelversorgung. Er erwähnte die tiefen Milchpreise und die Milchversorgung, die in einer unbefriedigenden Lage war. Dann sprach er über die Fleischversorgung, welche die Landwirtschaft zum Glück zu decken vermochte. Auch die unbefriedigende Kartoffelversorgung kam zur Sprache. Aber die Versorgung des Schweizervolkes mit Milch, Fleisch und Kartoffeln bereitete geringere Sorgen als die knappe Brotversorgung. Die Rationierung des Brotes und die gute Kartoffelernte konnte das Volk bis zur nächsten Ernte vor dem Hunger bewahren. Abschliessend referierte er über die hohen Lebensmittelpreise und über den Raubbau an der Landwirtschaft. Nach diesem ausgiebigen Überblick über die wirtschaftliche Lage des Bauernstandes kam nun Minger auf die politischen Zustände zu sprechen. Er blendete zurück zu den letzten Nationalratswahlen, wo der Bauervertreter Jenny erst im zweiten Wahlgang gewählt wurde. Er kam zum Schluss, dass der Proporz eine Gründung einer Bauernpartei nötig machte.
Minger wandte sich vor allem bei militärpolitischen Themen an das Volk. Er setzte sich mit seiner ganzen Hingabe und Beredsamkeit für den Neuaufbau der Armee, ihrer Bewaffnung, Ausbildung und Organisation und für die Hebung des Wehrwillens des Schweizer Volkes ein. Den Auftakt dazu bildete die Rede über „Unsere Landesverteidigung“ vom 26. Oktober 1930 in Gränichen im Aargau. Damit begann nicht nur der Kampf für die Armeereform, sondern auch die Auseinandersetzung mit den damals antimilitaristischen Führern der Sozialdemokratie. Die Gränicher Rede wurde anschliessend an sehr vielen Orten der Schweiz gehalten, zum Teil unter dem gleichen Titel oder aber unter der Benennung „Volk und Armee“.
Minger hielt Reden zur Parteigründung, als Nationalrat, als Bundesrat und selbst noch im Ruhestand wurde er gerne als Redner eingeladen. Insgesamt sprach er über 230-mal zu Publikum.
Redenverzeichnis ( bitte klicken sie hier )
„Bierhübeli-Rede“
Die wirtschaftliche Lage unseres Landes
mit besonderen Berücksichtigung der Landwirtschaft
Vortrag vom 24. November 1917 in der Abgeordnetenversammlung des Verbandes landwirt-schaftlicher Genossenschaften in Bern
Im Süden und im Westen, im Norden und im Osten Europas widerhallt der Donner der Ka-nonen in immer schärferer Tonart. Auf blutgetränkten Gefilden wird die Blüte der Menschheit, wird die Vollkraft der Nationen gebrochen. Der Blutstrom der Gefallenen mischt sich mit dem Tränenstrom der Hinterbliebenen. Wo früher eine arbeitsfreudige Bevölkerung friedlich ihrer Beschäftigung oblag, da finden wir heute vielfach nur noch öde Trümmerfelder. Das sind die Greuel des Krieges, und noch nirgends ist ein Schimmer von der längst ersehnten Morgenrö-te eines dauernden Friedens sichtbar.
Mitten in diesem Weltenbrand liegt, wie eine Friedensinsel, unser Vaterland. Bis heute hat der Krieg noch keine Lücken gerissen in unsern Familien; auch unsere Häuser, unsere Felder und Wälder stehen noch unversehrt da. An diese Tatsache wollen wir uns immer wieder erinnern; denn dieser Gedanke verleiht dem Schweizervolk diejenige Kraft, die in diesen kritischen Zei-ten für ein würdiges Durchhalten so notwendig ist.
Wenn bis heute die Schrecken des Krieges von unsern Gauen ferngehalten wurden, so ver-danken wir dies in erster Linie der Tüchtigkeit unserer Armee. Wir wollen deshalb diese Ar-mee in Ehren halten; denn wir haben sie nötig, jetzt und in Zukunft. Wenn gröbliche Fehler und Vorstösse vorkommen – und sie sind vorgekommen und sie werden auch in Zukunft nie gänzlich zu vermeiden sein — so ist es unser Recht und unsere Pflicht, dahinzuwirken, dass diese Missstände abgestellt werden. Aber es soll dies immer im Interesse der Armee ge-schehen und nicht, um dieselbe zu diskreditieren und unpopulär zu machen.
Unbegreiflich und unverständlich muss es einem erscheinen, dass in diesem Moment gewis-se Bevölkerungskreise jegliche Landesverteidigung verneinen können. In diesen Kreisen scheint jegliches Nationalitätsgefühl, jedes vaterländische Empfinden erloschen zu sein. Das sind meines Erachtens traurige Eidgenossen, die das moralische Recht, unser Land bewoh-nen zu dürfen, direkt verwirkt haben.
So glücklich wir uns einerseits schätzen dürfen, bis jetzt vorn Krieg verschont geblieben zu sein, so unglücklich sind andererseits die Wirkungen des Krieges für unser Land in wirtschaftlicher Beziehung. Nachdem unsere Zufuhren bei Ausbruch des Krieges eine so jähe Unterbindung erlitten, wurde unserem Volke plötzlich klar, in was für ein unangenehmes Ab-hängigkeitsverhältnis unser Land im Laufe der Jahre sich gegenüber dem Ausland verwickelt hatte, eine Tatsache, auf deren Gefährlichkeit unsere Bauernführer vor dem Krieg immer wieder aufmerksam machten. Leider wurden diese wohlgemeinten Ratschläge in massge-benden Kreisen vielfach überhört. Die Entwicklung des schweizerischen Wirtschaftslebens vor dem Krieg brachte es mit sich, dass unsere Landwirtschaft immer mehr in den Hinter-grund gedrängt wurde. Besonders günstig waren die wirtschaftlichen Verhältnisse für die Entstehung von Aktiengesellschaften. Dadurch wurden immer neue Unternehmungen ins Leben gerufen, pilzartig schossen immer mehr Fabriken aus dem Boden hervor. Unser Land stund im Zeichen eines grossartigen industriellen Aufschwunges. Es war deshalb gegeben, dass grosse Kreise unserer Bevölkerung davon überzeugt waren, dass die Industrie für unser Land das Alleinseligmachende bedeute. Denn die Industrie, so wurde argumentiert, schaffe Arbeitsgelegenheit in Hülle und Fülle, sie sei die eigentliche Verdienstquelle des Volkes, und die Mehrung der Industrie bedeute gleichzeitig eine Mehrung der Steuerkraft. Durch diese fortschreitende Industrialisierung wurden der Landwirtschaft immer mehr Leute entzogen und entfremdet.
In der Folge sehen wir das mächtige Anwachsen der grossen Gruppe der Konsumenten, welche ihre Kraft in einer starken Organisation zu konzentrieren sucht. Der wichtigste Pro-grammpunkt dieser Konsumentenorganisation bildete von jeher die Verbilligung der Le-bensmittel. Zur Erreichung dieses Zieles wurde mit Hochdruck auf die Abschaffung der Zölle auf sämtlichen Lebensmitteln hingearbeitet. Die Liga zur Verbilligung der Lebenshaltung und die Fusion des Verbandes schweizerischer Konsumvereine mit Bell AG verdanken ihre Ent-stehung dieser Tendenz. Man ging dabei von der ganz falschen Voraussetzung aus, dass unsere Nachbarstaaten die schweizerische Lebensmittelversorgung bei vollständiger Zoll-freiheit viel billiger bewerkstelligen können, als dies der hiesigen Landwirtschaft möglich sei, und dass man deshalb die letztere, wenn sie die ausländische Konkurrenz nicht auszuhalten vermöge, sehr wohl entbehren könne. Man hat zahlenmässig den Nachweis zu erbringen versucht, dass die schweizerische Landwirtschaft prozentual immer mehr zurückgehe und dass es deshalb erste Pflicht und Schuldigkeit der Behörden sei, der grossen Gruppe der Konsumenten durch Verbilligung der Lebensmittel ihre Existenzbedingungen zu erleichtern.
Es ist nun klar, dass diese Bestrebungen eine starke Gefährdung der bäuerlichen Interessen bedeuten. Deshalb hat man zu Abwehrmassnahmen Zuflucht nehmen müssen, und das führte zur Kräftigung und zum Ausbau unserer Produzentenorganisationen. Diesen genos-senschaftlichen Hochburgen, diesen Wahrzeichen eigener Kraft ist es zu verdanken, dass die schweizerische Landwirtschaft ihre Leistungsfähigkeit bewahren konnte, und das kommt heute nicht in letzter Linie denjenigen Bevölkerungsschichten zugut, die sich gewohnt sind, die bäuerlichen Forderungen am heftigsten zu bekämpfen.
Bei Ausbruch des Weltkrieges haben die früheren Verhältnisse ganz plötzlich eine Verschie-bung erfahren. Die Hauptsorge von Volk und Behörden hat sich naturgemäss auf die inländi-sche Lebensmittelversorgung konzentriert, und dadurch ist die vorher vielfach so verachtete Landwirtschaft mit einem Schlag in den Vordergrund gerückt, und alle Hoffnungen und Er-wartungen des Schweizervolkes haben sich an diesem „rettenden Fels im stürmenden Meer“ festgeklammert. Der schweizerische Bauernstand war sich seiner grossen Verantwortung von Anfang an sehr wohl bewusst. Er hat alle frühern Befehdungen und Anrempelungen auf die Seite geschoben und hat seine Bruderhand allen wirtschaftlichen Gruppen versöhnend entgegengestreckt, sich im Stillen gelobend, all den grossen Anforderungen nach Möglichkeit gerecht zu werden.
Wie hat die schweizerische Landwirtschaft diese Aufgaben bis heute erfüllt?
Als die vier Hauptpositionen in unserer Volksernährung wollen wir anführen die Versorgung unseres Volkes mit Milch und Milchprodukten, Brot, Fleisch und Kartoffeln. Alle übrigen Pro-dukte, die wir erzeugen, wie Gemüse, Obst, Eier usw., so wichtig sie auch sein mögen, so haben sie doch mehr nur ergänzende Bedeutung und dienen besonders dazu, unsere Menus etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Wir wollen nun auf die vier Hauptpunkte unserer Lebensmittelversorgung etwas näher eintreten.
Die Milchversorgung
Unsere Landwirtschaft hat jederzeit willig Hand geboten, um eine rationelle Milchversorgung unseres Landes zu ermöglichen. Mit Rücksicht auf die grosse Wichtigkeit, welche der Milch in der Volksernährung zukommt, hat man zum vornherein auf die hohen Preise, auf die man ein Anrecht gehabt hatte, verzichtet. Trotz den gewaltig gesteigerten Produktionskosten und trotz dem grossen Rückgang in der Milchproduktion hat man aus humanitären Rücksichten den besitzlosen Konsumenten gegenüber diese Opfer gebracht, obschon man wohl wusste, dass infolge daheriger Mindereinnahmen sich die Landwirtschaft Beschränkungen aller Art auferlegen muss. Gestützt auf dieses weitherzige Entgegenkommen seitens der milchwirt-schaftlichen Organisationen, konnte der Bundesrat seine Massnahmen treffen, und in der Folge ist der Konsummilchpreis tief geblieben.
Was das letzte Abkommen auf diesem Gebiet betrifft, so muss allerdings gesagt werden, dass dasselbe in Produktionskreisen nicht befriedigt. Wer mit den Produktionsverhältnissen nur einigermassen vertraut ist, der weiss, dass der verlangte Milchpreisaufschlag von zwei Rappen mehr als gerechtfertigt gewesen wäre. Wir wollen die Schwierigkeiten, unter welchen der Vertreter des Bundesrates die diesbezüglichen Verhandlungen zu leiten hatte, nicht verkennen; wir betrachten es jedoch als einen volkswirtschaftlichen Fehler, dass man den Mut nicht fand, dem Drucke der Konsumentenorganisationen etwas energischer entgegen-zuwirken. Ganz unverständlich bleibt für uns der Umstand, dass nun heute auch der wohlha-bende Konsument, derjenige, der gewaltige Kriegsgewinne einheimst, sogar der Millionär, das Bundesalmosen von einem Rappen per Liter Milch beziehen soll. Auch hat uns der Bundesrat in den letzten Tagen ein neues Rätsel aufgegeben, nämlich wie man es machen soll, aus sechzigfränkigem Ölkuchen 25- bis 28räppige Milch zu produzieren. Nachdem der Milchpreis staatlich festgesetzt wurde, hat man eine Anpassung der Ölkuchenpreise ohne weiteres erwartet. Leider trifft dies nicht zu, und heute sieht sieh der Bauer in die Zwangslage versetzt, trotz finanzieller Einbusse Ölkuchen verfüttern zu müssen. Uns will scheinen, man treibe hier ein etwas gefährliches Spiel mit der bäuerlichen Gutmütigkeit.
Als treue Söhne unseres Landes haben wir schliesslich das Versprechen gegeben, uns in die neue Ordnung der Dinge zu fügen, machen aber darauf aufmerksam, dass der Bogen sehr stark gespannt ist, und wenn diesen Winter eine drohende Milchknappheit eintreten sollte, so müssen und dürfen wir die Verantwortung hierfür ablehnen.
Die Fleischversorgung
In organisierten Konsumentenkreisen wurde früher mit allem Nachdruck behauptet, die in-ländische Fleischproduktion könne der Nachfrage bei weitem nicht mehr genügen und man müsse deshalb der Einfuhr von ausländischem Schlachtvieh und Fleisch durch Abschaffung der Zölle Tür und Tor öffnen. Heute wissen wir, dass diese Behauptung nicht zutrifft, sondern dass unsere Viehhaltung imstande ist, der inländischen Fleischversorgung genügen zu kön-nen. Nach dieser Richtung hin hat die schweizerische Landwirtschaft alle Erwartungen weit übertroffen. Was nun
Die Kartoffelversorgung
anbetrifft, so hatten wir leider im Herbst 1916 eine totale Missernte zu verzeichnen. Die dar-aus resultierenden Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Lebensmittelversorgung sind uns noch sehr wohl in Erinnerung, und sie haben uns die hohe Bedeutung, welche der Kartoffel in der Volksernährung zukommt, so recht deutlich vor Augen geführt. Es muss deshalb als ein Glück für unser Land bezeichnet werden, dass die diesjährige Ernte so reichlich ausgefallen ist. Vor dem Krieg hat das schweizerische Bauernsekretariat eine Normalernte auf neun Millionen Zentner eingeschätzt. Eine Million Zentner wurde als Saatgutreserve berechnet, und der Rest fand zu Brenn- und Fütterungszwecken Verwendung; wenn die Einfuhr gross war, so wurden dementsprechend mehr verfüttert. Dank den vorsorglichen Massnahmen des Bundesrates hat die Anbaufläche für Kartoffeln letztes Frühjahr eine wesentliche Vermehrung erfahren; sie betrug 60’000 Hektaren. Bei einer Ertragsberechnung von 200 Zentnern pro Hektare — so viel dürfen wir dieses Jahr rechnen — erreicht der Gesamtertrag die Höhe von 12 Millionen Zentnern. Nun muss damit gerechnet werden, dass für Konsumzwecke ganz andere Quantitäten benötigt werden als in normalen Zeiten. Aber auch wenn wir beispielsweise eine Zunahme von fünfzig Prozent in Anrechnung bringen, so bleiben uns immer noch wesentliche Mengen für die Verfütterung, speziell für die Schweinemast, und dadurch werden wir in die Möglichkeit versetzt, dem herrschenden Fettmangel wenigstens einigermassen entgegenzutreten.
Es scheint nun, dass in letzter Zeit die Nachfrage nach Speisekartoffeln besonders lebhaft eingesetzt hat, so dass die Zentralstelle für Kartoffelversorgung den Anforderungen nicht mehr genügen kann. Diese Nachfrage mag wohl zu einem grossen Teil darauf zurückzufüh-ren sein, dass die Fürsorgekommissionen ihren Bedarf mit billigen deutschen Kartoffeln ein-zudecken beabsichtigen. Leider ist diese Ware mit Bezug auf Qualität hinter den Erwartungen zurückgeblieben, und es würde heute dem Vorsteher des Eidgenössischen Kartoffelamtes nicht schwer fallen, die richtige Antwort geben zu können auf die Frage, warum die deutschen Kartoffeln billiger seien als die schweizerischen.
Die Anstrengungen, die noch vorrätigen Kartoffeln aus den Kellern herauszubringen, werden erst dann den gewünschten Erfolg haben, wenn man bei der Preisfestsetzung dem Ge-wichtsverlust und der Mehrarbeit gegenüber der Ablieferung direkt vom Feld genügend Rechnung trägt. Es ist ja klar, dass heute in erster Linie der Konsument mit Kartoffeln ver-sorgt werden muss, und sollte dies freiwillig nicht möglich sein, so müsste der Zwangsweg betreten werden. Zwangsmassnahmen sind jedoch nur dann am Platze, wenn vorher der Preis in richtigen Einklang gebracht wurde mit dem Arbeitsaufwand.
Leider ist man auf den unglücklichen Gedanken gekommen, durch das Mittel der Kompensa-tion die Produzenten zur Ablieferung von Kartoffeln zu veranlassen, indem das Volkswirt-schaftsdepartement für drei Wagen gelieferte Kartoffeln einen Wagen Ölkuchen zum Preise von 55 Franken per hundert Kilo franko Bahnstation abgibt. Diese Art des Austausches wurde schon früher in ähnlichen Fällen öfters angewendet. Wir wollen die guten Absichten, die das Volkswirtschaftsdepartement zu einem derartigen Vorgehen veranlasst haben, nicht be-zweifeln, aber andererseits muss doch einmal auf die grossen Mängel, die einem derartigen Verfahren anhaften, hingewiesen werden. Einmal bedeutet dies eine Prämiierung derjenigen Produzenten, die in gewinnsüchtiger Absicht ihre Produkte dem Markt fern- zuhalten versu-chen, bis eine gewisse Knappheit eintritt, um sodann höhere Preise zu erzielen. Das haben wir zum Beispiel letztes Frühjahr bei den Saatkartoffeln erlebt. Damals hat man den Preis erhöht auf 32 Franken unter gleichzeitiger Abgabe einer Extraprämie, bestehend in Mais. Von diesem Moment an gab es natürlich nur noch Saatkartoffeln und keine Speisekartoffeln mehr. Diejenigen, welche ihre Überschüsse rechtzeitig dem Konsum zuführten, geleitet von dem aufrichtigen Bestreben, die Verhältnisse in der Kartoffelversorgung unseres Landes erleichtern zu helfen, hatten das Nachsehen. Ähnlich ging das Oberkriegskommissariat vor beim Einkauf von Getreide. Wer sein Getreide zurückbehielt bis in den Sommer, der erzielte ebenfalls einen höhern Preis und erhielt als Ersatz Mais oder Gerste zugeteilt.
In zweiter Linie sodann schafft man auf diese Weise Ungleichheiten in der Verteilung der knappen Vorräte von Futtermitteln. Es sollte heute als selbstverständlich erscheinen, dass auf diesem Gebiet eine möglichst gleichmässige Verteilung angestrebt werden muss. Zur Erfüllung dieser so wichtigen Aufgabe sind in erster Linie die landwirtschaftlichen Genossen-schaftsverbände und die landwirtschaftlichen Genossenschaften die berufenen Organe. Sie allein bieten die nötigen Garantien, dass besonders auch der wirtschaftlich Schwächere zu seinem Recht kommt. Man wird allerdings den Einwand gelten lassen müssen, unsere Or-ganisation sei nicht lückenlos ausgebaut. Aber auch hier dürfte ein Ausgleich nicht schwer fallen. Wo heute die landwirtschaftlichen Genossenschaften noch fehlen, könnten die Ver-bände sehr wohl mit den Gemeindebehörden in Verbindung treten. Man soll nur einmal die sämtlichen Kraftfuttermittel den Genossenschaftsverbänden im Verhältnis der Produktions-bedeutung in ihren Tätigkeitsgebieten zuweisen, und die Verteilung auf die Einzelproduzenten wird eine glatte Abwicklung erfahren, die allgemein befriedigt. Die Verteilungsart, wie sie bis jetzt praktiziert wurde, ganz besonders diese Extrazuteilung auf dem Wege des Austausches, schafft Konfusionen, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten und dementsprechend grosse Unzufriedenheiten.
In den letzten Tagen ist uns nun die Nachricht zugegangen, man habe, was den Kartoffel-handel anbetrifft, die ursprüngliche Verfügung über die Zuteilung von Ölkuchen aufgehoben und den Preis für Kartoffeln entsprechend erhöht. Dieses Vorgehen wird in unsern Reihen lebhafte Zustimmung finden und ausserordentlich beruhigend wirken. Gestützt auf diese neueste Massnahme, möchte ich die anwesenden Vertreter der landwirtschaftlichen Genos-senschaften ersuchen, alles zu tun, um die noch vorrätigen Kartoffeln bei ihren Mitgliedern freizubekommen, damit der Weg der Zwangsenteignung vermieden werden kann.
Im Interesse des Ganzen muss es der Wunsch der heutigen Versammlung sein, man möchte für die Zukunft an massgebender Stelle ein für allemal von solch gefährlichen Lockmitteln Umgang nehmen.
Die Brotversorgung
Wir haben konstatiert, dass die schweizerische Landwirtschaft die Möglichkeit besitzt, unser Land mit Milch, Fleisch und Kartoffeln genügend versorgen zu können. Anders liegen die Verhältnisse auf dem Gebiet der Brotversorgung. Schon seit Jahrzehnten ist der inländische Getreidebau dem billigen Brot zuliebe preisgegeben worden. Ausländisches Brotgetreide hat zollfrei unsere Grenzen passiert und hat dadurch unsern Getreidebauern jede Rendite ver-unmöglicht. Vor dem Krieg betrug der Anteil der inländischen Produktion an der Brotversor-gung des Landes nur noch 16 Prozent und hätte somit für 59 Tage pro Jahr genügt. Durch das Verfütterungsverbot und durch die bessere Mahlausbeute kann dieser Anteil auf etwa 32 Prozent gesteigert werden. Wir sehen somit, in was für einem gefährlichen Abhängigkeits-verhältnis gegenüber dem Ausland wir uns auf diesem Gebiete befinden.
Glücklicherweise haben sich die Zufuhren bis vor kurzem in recht befriedigender Weise ab-gewickelt. Leider haben die Verhältnisse durch den deutschen Unterseebootskrieg und be-sonders auch durch den Eingriff Amerikas in den Weltkrieg eine Zuspitzung erfahren, wodurch die kriegführenden Staaten zu den schärfsten Massnahmen gezwungen wurden. Dadurch haben unsere Zufuhren eine derartige Unterbindung erlitten, dass wir uns heute in bezug auf unsere Lebensmittelversorgung mit dem Gedanken vertraut machen müssen, mit den noch vorhandenen Vorräten und mit unserer Inlandproduktion auszukommen.
Wie ein Gespenst grinst uns heute die Frage um das tägliche Brot entgegen. Der Bundesrat sah sich in die Notwendigkeit versetzt, die Rationierung des Brotes durch Aufstellung von Vorschriften vorzunehmen. Es ist heute nicht mehr notwendig, auf diese Vorschriften näher einzutreten; denn wir haben dieselben bereits in der Praxis kennen gelernt. Durch das Mittel der Rationierung und besonders auch dank der so günstigen Kartoffelernte wird es möglich werden, bis zur nächsten Ernte durchzuhalten. Nun kommt aber die wichtige und unheimliche Frage: In was für Verhältnissen werden wir uns übers Jahr befinden? In unserem Optimismus haben wir schon lange an einen baldigen Frieden geglaubt. Wir dürfen das auch weiterhin hoffen, aber ein gewaltiger Fehler wäre es, wollten wir unsern Kurs auf diese Friedens-hoffnungen einstellen.
In Würdigung dieser schwierigen Verhältnisse hat der Bundesrat die Vermehrung des inlän-dischen Brotgetreidebaues um 50’000 Hektaren beschlossen. Dieses Vorgehen des Bundes-rates muss auch in Produzentenkreisen als absolut notwendig und richtig anerkannt werden. Was uns Berner Bauern im ersten Moment etwas verstimmte, das ist das grosse Kontingent von über 10’000 Hektaren, das man uns als Mehranbau zuteilte. Wir wissen sehr wohl, dass, wenn man in andern Gebieten der Schweiz in dem Umfange Getreide pflanzen würde, wie dies bis jetzt im Kanton Bern der Fall war, die verlangten 50’000 Hektaren Mehranbau auch ohne unser Zutun erreicht würden. Aber wir müssen eben die grossen Schwierigkeiten, die sich bei der Einführung des Getreidebaues unsern ostschweizerischen Kollegen entgegen-stellen, verstehen lernen. Ihnen fehlten in erster Linie die nötigen Ackergerätschaften: Pflug, Egge, Sämaschine usw. Ferner fehlt die Dreschmaschine; auch ist man nicht eingerichtet für die Einlagerung von Garben und von gedroschenem Getreide. Sodann fehlen besonders auch die nötigen Kenntnisse für den Getreidebau. All das muss zuerst erworben werden. Wenn dies einmal zutrifft, dann allerdings dürfen wir von ihnen ein Mehreres verlangen.
Wenn man diese Verhältnisse berücksichtigt, und wenn man bedenkt, dass die bundesrätliche Verfügung viel zu spät erschienen ist, so muss man zu der Überzeugung gelangen, dass die Sicherstellung der Brotversorgung für das Jahr 1918/19 nur möglich ist, wenn wir Berner Bauern alles daran setzen, den uns zugemuteten Verpflichtungen nachzukommen. Soweit meine Beobachtungen reichen, darf ich heute konstatieren, dass die bernische Landwirtschaft es damit ernst genommen hat und dass der gute Wille, sein möglichstes zu tun für des Landes Wohl, überall vorhanden ist.
Bei dieser Gelegenheit ist es wohl auch angezeigt, auf die grosse Bedeutung hinzuweisen, die der bernischen Landwirtschaft auf dem Gebiete der schweizerischen Lebensmittelproduktion zukommt. Nach der schweizerischen Anbaustatistik des Jahres 1917 beträgt die Anbaufläche von Getreide für die ganze Schweiz 117’000 Hektaren. Hievon entfallen auf unsern Kanton 32’000 Hektaren. Bei den Hackfrüchten ist das Verhältnis ähnlich. Von 61’000 Hektaren Totalfläche kommen auf den Kanton Bern 18’000 Hektaren. Im fernern ist bekannt, dass der Kanton Bern sich an der Schlachtviehlieferung mit einem Drittel beteiligt hat. Im weitern darf noch hingewiesen werden auf die wichtige Rolle, die uns zukommt auf dem Gebiete der Milchversorgung, der Käse- und Butterfabrikation. Wenn ich auf diese Tatsachen hinweise, so soll dadurch nicht etwa der „Kantönligeist“ besonders gefördert werden, sondern ich möchte vielmehr dem berechtigten Verlangen Ausdruck geben, dass man uns in Zukunft bei der Zuteilung von Futter- und Düngemitteln entsprechend der Wichtigkeit unserer Produktion berücksichtigt.
Durch die erlassenen und noch zu erlassenden Produktionsvorschriften wird die schweizeri-sche Landwirtschaft fast ausschliesslich auf die inländische Lebensmittelversorgung einge-stellt. Die Ausdehnung des Getreidebaues bedingt eine Einschränkung der Viehhaltung. Schon häufig habe ich die Ansicht vertreten hören, die Ställe seien auch gegenwärtig noch mit Vieh überstellt. Ich teile diese Ansicht. Die Ursache dieser Erscheinung muss wohl in den schlechten Exportverhältnissen und sodann besonders auch in dem künstlich herbeigeführten Preissturz gesucht werden. Diese unglückliche Massnahme, die in unsern Kreisen mit Recht so viel Missstimmung hervorrief, könnte sich bitter rächen, wenn sich die Landwirte darauf versteifen sollten, das letztes Frühjahr vielfach so teuer gekaufte Vieh nun nicht mit Verlusten abstossen zu wollen. So schwer es einem auch fallen mag, so halte ich jedoch dafür, es sei das klügste, sich den Verhältnissen anzupassen und den Viehstand mit den Heustöcken in Einklang zu bringen. Der hohe Ölkuchenpreis, der in einem totalen Missverhältnis zum Milchpreis steht, kann nicht zum Durchhalten allzu grosser Viehstände ermutigen. Die Futter-kalamität des letzten Frühjahrs ist uns allen noch sehr wohl in Erinnerung. Eine Wiederholung derartiger Zustände muss vermieden werden, und hier waren die landwirtschaftlichen Genossenschaften die berufenen Organe, aufklärend auf ihre Mitglieder einzuwirken.
Eine Abnahme der Viehbestände bedingt naturgemäss auch ein Zurückgehen der Milchpro-duktion, und dadurch wird ganz besonders die Fettkäsefabrikation für den Export schwer betroffen. Dieselbe wird namentlich auch zurückgedrängt, um durch vermehrte Buttererzeu-gung die Verhältnisse auf dem Gebiet der Fettversorgung erträglich zu gestalten. Bis jetzt war der Exportkäse eine äusserst wichtige Kompensationsware. Für die Zukunft wird dies nur noch in beschränktem Masse zutreffen. Das gleiche gilt für das Exportvieh. Inwieweit man den Kondensmilch- und Schokoladefabrikanten den Export gestattet, entzieht sich meiner Kenntnis. Als wichtigster Kompensationsgegenstand bleibt uns noch das Holz. Aber auch hier hat man zu ernsten Bedenken Ursache. Bis jetzt hat der Kompensationsverkehr eine äusserst wichtige Rolle gespielt. Denn nur durch dieses Mittel wurde es möglich, unserer Industrie die nötigen Rohstoffe zuzuführen und so die Schliessung der Fabriken und das Freiwerden der Arbeitermassen zu verhindern. Es drängt sieh einem deshalb die bange Frage auf: Wie soll das in Zukunft werden?
Die Abweisung der Gefahr liegt darin, dass unsere Industrie ihren Betrieb heute zum grössten Teil auf Kriegsproduktion eingestellt hat. Der Austausch mit dem Ausland vollzieht sich zwischen Rohstoffen und fertigen Waren, und dadurch wird der Mangel an Kompensations-waren ausgeglichen. Im übrigen scheint auch das hochkursige Schweizer Geld dazu berufen zu sein, ausgleichend zu wirken.
Durch die Verschiebung dieser Verhältnisse wird die schweizerische Landwirtschaft in die Möglichkeit versetzt, ihre volle Produktionskraft in den Dienst der inländischen Lebensmittel-versorgung zu stellen und ihre Betriebsrichtung so auszuwählen, dass dem gefährlichen Ab-hängigkeitsverhältnis gegenüber dem Ausland äusserst wirksam entgegengetreten werden kann. Diese Anpassung im Interesse der Konsumenten bringt jedoch für uns Landwirte ganz einschneidende Veränderungen. Wir benötigen in erster Linie viel mehr menschliche und tierische Arbeitskräfte. Sodann müssen Gerätschaften und Maschinen aller Art zu horrenden Preisen angeschafft und Neueinrichtungen in Scheune und Speicher getroffen werden. Damit übernimmt der Bauer ein grosses Risiko, welches nur dadurch abgeschwächt werden kann, dass man uns von Staates wegen Garantien schafft, welche ein plötzliches Zurückgehen unserer Produktenpreise nach Friedensschluss verhindern. Leider ist in dieser Richtung bis heute noch nichts geschehen. Man weist daraufhin, dass, so wie die Verhältnisse heute liegen, diese Gefahr überhaupt nicht bestehe. Allein die Wirklichkeit hat schon gar so oft menschliche Berechnungen auf den Kopf gestellt, und deshalb erscheint es wünschenswert und notwendig, dass man uns in angedeutetem Sinne eine sichere Basis schafft.
Nie mehr als heute muss es einem zum Bewusstsein kommen, dass von allen wirtschaftli-chen Gruppen der Schweiz unserer Landwirtschaft die weitaus grösste Bedeutung zukommt. Von ihr hängt Sein oder Nichtsein unseres Landes ab. Man dürfte deshalb glauben, dass diese Überzeugung die weitesten Kreise unseres Volkes beherrschen sollte und dass man diese Verdienste des Bauernstandes offen und ehrlich anerkennen würde, Stattdessen müs-sen wir so vielfach das Gegenteil erfahren. Die gleichen Leute, die vor dem Krieg unsere Landwirtschaft als abgenütztes Inventarstück in die Grümpelkammer verbannen wollten, schrecken heute nicht davor zurück, lärmende Strassendemonstrationen zu veranstalten, wobei man Schimpf auf Schimpf und Hohn auf Hohn häuft gegen uns Bauern. Wo man uns als Ausbeuter, Wucherer bezeichnet, wo man von unsern Behörden verlangt, dass sie den Bauernstand in einen Sklavenstand verwandeln, und es muss geradezu als ein Skandal be-zeichnet werden, wie sich die sozialdemokratische Presse dem Bauernstand gegenüber be-nimmt. Das alles spielt sich ab in einer Zeit, da der Bauernstand unter Anspannung aller Kräfte einer allgemeinen Aushungerungsgefahr und Verdienstlosigkeit vorzubeugen sucht. Meine Herren, gegen eine derartige Verhöhnung unseres Standes möchte ich hiermit Protest einlegen!
Warum werden wir in dieser Zeit so angefeindet? Der Grund liegt in den hohen Lebensmit-telpreisen. Wir wissen sehr wohl, dass infolgedessen in gar vielen Familien die Not vor der Tür steht. Es ist keine Kleinigkeit für einen mittellosen Familienvater mit zahlreicher Familie, schlicht und recht durchzukommen in so schwierigen Zeiten. Aber gerade für solche Verhält-nisse finden wir in bäuerlichen Kreisen weitgehendes Verständnis. Es darf einmal öffentlich darauf hingewiesen werden, dass der Bauer vielfach an praktischem Sozialismus ungleich viel mehr tut als mancher, der sich als der Hüter der Arbeiterinteressen auszugeben berufen fühlt. Nach dem Sprichwort, „die linke Hand darf nicht wissen, was die rechte tut“, wandert gar manche Gabe in dieser oder jener Art aus dem Bauernhause ab, um notlindernd zu wir-ken im Kreise unbemittelter Familien. Im ferneren darf die Abgabe von Gratispflanzland und die Gratisfuhrungen in den verschiedensten Formen erwähnt werden. Wollte man diese Leis-tungen in Werte umsetzen, so gäbe dies gewaltige Summen. Deshalb muss es als eine be-dauerliche Erscheinung bezeichnet werden, dass man mit allen Mitteln den Arbeiterstand auf dem Lande gegen die landwirtschaftliche Bevölkerung aufzuhetzen versucht. In den Städten mögen die Verhältnisse wesentlich anders liegen. Aber eines ist sicher: Der Bauernstand ist jederzeit bereit, der arbeitenden Klasse durch die Verwirklichung sozialer Reformen ihre Existenzbedingungen verbessern zu helfen. Er wird auch den berechtigten Forderungen der Fixbesoldeten gewiss zum Durchbruch verhelfen, aber alles unter der Bedingung, dass man von diesen Seiten auch für uns Bauern das gleiche Recht anerkennt.
Die Existenzmöglichkeit der Landwirtschaft beruht nun einmal auf angemessenen Produkti-onspreisen. Dadurch ist allerdings zwischen Konsument und Produzent eine Reibungsfläche geschaffen, ehe nie ganz erkalten wird. Wir meinen, es sollte der Ausweg darin gesucht werden, dass die Lohnverhältnisse der nichtproduzierenden Bevölkerungsgruppen mit der Höhe der Lebensmittelpreise in Einklang gebracht werden. Der umgekehrte Weg ist falsch.
Der Vorwurf von übersetzten Produktenpreisen, wobei die Landwirtschaft wucherische Ge-winne erziele, zeugt davon, dass man die Verhältnisse, unter welchen zurzeit produziert werden muss, nicht versteht oder nicht verstehen will. Man weist auf die vermehrten Sparein-lagen hin, de heute besonders bei den ländlichen Geldinstituten zusammenfliessen. Diese Tatsache mag zutreffen, aber woher rühren eigentlich diese vermehrten Barmittel? Einmal ist der Wald bedeutend kapitalfrei geworden. Diesem Kapital steht heute der entwertete kahle Waldboden gegenüber. Sodann hat der Viehstand, besonders der Bestand an Kühen, eine wesentliche Reduktion erlitten. Dadurch wurde ein Teil des Viehkapitals flüssig gemacht. Im weitern fehlte uns die Gelegenheit, Futter und Düngemittel in auch nur annähernd genügen-den Mengen einkaufen zu können. Auch hier bleibt uns ein Teil des Geldes im Sack, das wir unbedingt in anderer Form unserm Grund und Boden wieder zuführen sollten. Auch wird mit den Bauten auf der ganzen Linie zurückgehalten. Nur das Allernotwendigste wird ausgeführt. Man will bessere Zeiten abwarten.
Wir treiben heute eine ganz gefährliche Raubwirtschaft, und mit der Ausdehnung des Getrei-debaues wird dieses Übel noch intensiver. Die alten Dauerwiesen werden umgepflügt und die reservierte Bodenkraft aufgezehrt. Durch die Einschränkung der Viehhaltung wird auch der natürliche Dünger immer knapper. Alles, was uns das Gut heute liefert, wird verkauft, wird umgesetzt gegen bar. Wenn das so weiter geht, so wird in absehbarer Zeit unsere Produktion bedenklich zurückgehen müssen. Diese Raubwirtschaft geschieht auf Kosten der Produktionsfähigkeit unseres Landes. Sie bedeutet nichts anderes als ein Umsetzen eines Teiles unseres Bodenkapitals in bares Geld. Wenn wieder normale Zeiten kommen, so wer-den diese flüssig gewordenen Gelder durch unsere Güter rasch wiederum aufgesogen sein. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch noch anführen, wie schwer die allgemeine Teuerung auch unsern Stand erfasst hat. Alle Artikel für den täglichen Bedarf sind im Preise gewaltig gestiegen und zeigen immer noch steigende Tendenz. Nehmen wir zum Beispiel die Kleider, besonders die Schuhwaren, oder auch die Lebensmittel, die wir nicht selbst produzieren, wie Teigwaren, Zucker, Kaffee usw. Alle diese Sachen belasten unser Haushaltungsbudget aus-serordentlich schwer. Aber noch viel schwerer drücken uns die hohen Preise auf all unsern Werkzeugartikeln, auf Maschinen und Gerätschaften aller Art. Man braucht nur einmal die Rechnungen unserer Berufsleute, wie Schmied, Schlosser, Mechaniker, Sattler, Wagner usw. zu vergleichen mit den Rechnungen von früher, um den gewaltigen Umsatz der Teue-rung zu konstatieren. Aber auch auf die hohen Futter- und Düngemittelpreise muss hinge-wiesen werden. Für diesjährigen Ölkuchen beträgt der Aufschlag gegenüber früher 300 Pro-zent.
Alle diese Faktoren haben die Produktionskosten enorm gesteigert. Ich möchte deshalb allen denjenigen Kreisen, die heute glauben, ihre Grösse in der Beschimpfung der Landwirtschaft beweisen zu müssen, den Rat erteilen, sich einmal ganz ernstlich in Gedanken in die schwierige Lage unseres Standes zu versetzen, und alle Kritik an den hohen Produktepreisen würde zerfliessen, und staunend würde man die grosse Duldsamkeit des Bauernstandes bewundern müssen. Ein Stand, der heute im Interesse der Allgemeinheit so Grosses leistet, mit dem soll nicht kleinlich gemarktet werden, sondern ihm gebührt der Dank des Vaterlan-des.
Werte Abgeordnete! Wir ahnen und fühlen es: Wir stehen am Vorabend einer neuen Zeit. In der ganzen Welt hat eine Gärung eingesetzt, die gewaltsam eine Abklärung fordert. Was nun diese neue Epoche alles bringen wird, das ist noch in mysteriöses Dunkel gehüllt. Die ein-zelnen Linien, die sich allmählich abzuheben beginnen, gestatten noch keine zuverlässigen Schlussfolgerungen. Die wirtschaftliche Ausgestaltung unseres Landes wird sich den interna-tionalen Verhältnissen anpassen müssen. Für uns handelt es sich heute in erster Linie darum, alles zu tun, um von den Ereignissen nicht überrascht zu werden. Scharfes Beobachten, rasches Entschlussfassen und energisches Handeln, das müssen die zukünftigen Grundlagen bilden für die Sicherstellung des Erfolges.
Was speziell unsern Genossenschaftsverband anbetrifft, so muss mit Bestimmtheit ange-nommen werden, dass, wenn uns die Verhältnisse wieder einmal eine freie Betätigung er-lauben, wenn die Fesseln, in denen wir heute schmachten, gesprengt sein werden, wenn wir uns der Freiheit des Handelns wieder erfreuen dürfen, wir gleichzeitig auch an die Lösung von ganz neuen Aufgaben herantreten müssen. Um einen rationellen Einkauf unserer Waren zu ermöglichen, ist die Erschliessung direkter Bezugsquellen erstes Erfordernis. Das Mittel, dies zu erreichen, liegt in der Konzentration der Kaufkraft, und deshalb muss die Frage des Zusammenschlusses unserer schweizerischen landwirtschaftlichen Genossenschaftsver-bände in den Vordergrund unserer Verhandlungen treten, und alle kleinlichen Bedenken die-ser oder jener Art müssen im Interesse des Ganzen energisch zurückgedrängt werden. Im fernern ist es möglich und wahrscheinlich, dass uns die Macht der Verhältnisse neue Tätig-keitsgebiete zuweist, Auch die genossenschaftliche Verwertung unserer Produkte steckt noch sehr in den Anfängen und bedarf der Vervollkommnung. Wir sehen, ein vollgerüttelt Mass von Arbeit wird uns die Zukunft bringen. Um diese Arbeit möglichst fruchtbar und segensreich zu gestalten, ist es notwendig, dass unser Verband einen lückenlosen Aufbau erfährt, dass der genossenschaftliche Geist und die Genossenschaftstreue auch im hintersten Winkel Einkehr halten. Der Krieg hat uns ja so deutlich die Notwendigkeit einer straffen Organisation vor Augen geführt, ja, er hat sie diktatorisch gefordert. Dies trifft natürlich nicht nur zu für die Landwirtschaft, sondern auch alle anderen Berufsgruppen werden als geschlossenes Ganzes aus diesen kritischen Zeiten hervorgehen.
Was wird nun dieser Zusammenschluss der einzelnen Interessengruppen zur Folge haben? Die Wirkungen dieses Vorgehens haben bereits eine scharfe Kennzeichnung erfahren, und eine politische Neuorientierung unseres Landes wird die unmittelbare Folgerung sein.
Hiemit sind wir glücklich auf einem Gebiet angelangt, das wir sonst bei genossenschaftlichen Zusammenkünften nicht gewohnt waren zu betreten, es ist das Gebiet der Politik. Aber ge-wisse Erscheinungen anlässlich der letzten Nationalratswahlen verbieten uns geradezu ein längeres Stillschweigen. Sie kennen die Erscheinungen, die ich meine. Mit Spannung hat die ganze schweizerische Landwirtschaft den Ausgang der Nationalratswahlen im bernischen Mittelland verfolgt. Man war sich sehr wohl bewusst, was auf dem Spiele stand. Wir haben es erleben müssen, dass einer unserer besten und bewährtesten Vertreter im eidgenössischen Parlament, unser verehrter Verbandspräsident, Herr Jenny, im ersten Wahlgang bedenklich in Minderheit blieb. Diese Erscheinung ist umso unbegreiflicher, als man weiss, dass Herr Nationalrat Jenny sich nie in kleinlicher Interessenpolitik verlor, sondern die Prüfung aller Fragen immer in objektiver Art und Weise von grossen allgemeinen Gesichtspunkten aus vornahm. Deshalb muss es als ein Hohn bezeichnet werden, dass eine derartige Gefährdung überhaupt möglich sein konnte. Das gleiche trifft auch zu für Herrn Nationalrat Hirter. Es brauchte gewaltige Anstrengungen, um den Genannten im zweiten Wahlgang eine Wiederwahl zu ermöglichen. Heute sind die beiden glücklich gewählt, und es wird dies in unseren Kreisen beruhigend wirken. Damit ist die Sache jedoch nicht erledigt. Wir dürfen und wollen es nicht mehr zugeben, dass unsere Vertreter in der Bundesversammlung machtlos dem Spiel des Zufalls und der Verhältnisse ausgeliefert sind. Ich hoffe, dass dieses Vor-kommnis genügt, um uns endgültig die Augen zu öffnen.
Der Weg, den wir zu gehen haben, ist vorgezeichnet und heisst Proporz. In der Überlegung, es könnte der ideale Schwung, der einer grosszügigen Politik eigen sein muss, durch die Einführung des Proporzes leicht in ein kleinliches, fruchtloses Gezänke ausarten, haben wir früher dieses System bekämpft. Heute sind die Verhältnisse anders geworden. Man sucht auch bei der gegenwärtigen Politik umsonst nach Idealen. Nach dieser Richtung hin ist nichts mehr zu verlieren. Der Proporz wurde von anderer Seite auf den Schild erhoben, und wir haben heute allen Grund, uns dieser Bewegung anzuschliessen.
Es dürfte angezeigt sein, sich schon heute Rechenschaft zu geben über die Wirkung dieser Neuerung. Wir sehen, wie sich die wirtschaftlichen Interessen scharf gruppieren. Diese Aus-scheidung hat eine typische Illustration erfahren in den Bestrebungen der Fixbesoldeten der Stadt Bern. Ein Zeichen der Zeit, wer will es ändern? Der Proporz wird diese Gruppierungen mächtig fördern. Für uns — und das dürfen wir schon heute ruhig ins Auge fassen—gibt‘s meines Erachtens nur eine richtige Lösung, und das ist die Gründung einer Bauernpartei.
Man ist bis jetzt vor diesem Gedanken in den eigenen Reihen zurückgeschreckt. Aber heute lassen die Zustände kein anderes Vorgehen mehr zu. Es muss für die Zukunft vermieden werden, dass man sich in den eigenen Reihen politisch bekämpft. Uns Bauern vereinigt das gleiche Interesse, und die Gründung einer eigenen Partei muss dazu dienen, noch beste-hende Gegensätze auszugleichen.
Unser Schweizervolk setzt sich aus verschiedenen Wirtschaftsgruppen zusammen. Diese letztem machen schon heute — und mit Recht — auf der ganzen Linie Anspruch auf ange-messene Vertretung im Parlament. Dies wird beim Proporz noch viel scharfer zum Ausdruck kommen. Die Zusammenstellung des Parlaments wird eine andere werden. Eine Mehrheits-partei gibt‘s nicht mehr, sondern es wird der Weg der Verständigung zwischen den einzelnen Gruppen gesucht werden müssen.
Was die Landwirtschaft anbetrifft, so darf gesagt werden, dass wir bis jetzt in der Zuteilung von Mandaten nicht spärlich bedacht wurden. Mit Rücksicht auf die hohe Bedeutung, die unserem Stand zukommt, erscheint es an der Zeit, dass man auch uns ein vermehrtes Mit-spracherecht in öffentlichen Landesangelegenheiten gewährt. Die Zukunft wird unser Land vor die Lösung schwieriger Aufgaben stellen. Ich möchte nur erinnern an die Erneuerung der Handelsverträge, an die Sanierung unserer Finanzen, an die Lösung der Fremdenfrage, an die Einführung der Alters- und Invalidenversicherung, die ganz besonders für unser landwirt-schaftliches Dienstpersonal wertvoll wäre usw. Wenn wir aber an der Lösung dieser und spä-terer Fragen aktiven Anteil nehmen wollen, so müssen wir unsern Vertretern das nötige Rüstzeug mitgeben können. Hiemit käme ich neuerdings auf ein Gebiet zu sprechen, das ich schon früher bei einem andern Anlass kurz streifte, nämlich vermehrte Schulung der bäuerli-chen Jungmannschaft auf bäuerlichem Gebiet.
Der Vorstand der Ökonomischen Gesellschaft hat damals diese Anregung zur Prüfung ent-gegengenommen. Seither habe ich nichts mehr darüber erfahren, und ich will mich auch heute nicht weiter dazu äussern, aber ich hoffe, und es wäre wirklich zu wünschen, dass man sich um das Studium dieser Frage bemühen wird. Als Vertreter in unserer Landesbehörde sind nur Männer gut genug, die über das nötige Wissen und über den nötigen Weitblick verfügen. Selten einer ist hiezu von Natur aus befähigt, und deshalb müssen solche Männer erzogen werden. Nebst der Wahrung der beruflichen Interessen darf der Blick fürs Ganze nie verloren gehen. Wir wollen einem gesunden Fortschritt huldigen: Wir wolllen mitwirken an der wohnlichen Ausgestaltung unseres Staatsgebäudes, und unser Bestreben soll dahin tendieren, ein heimeliges Zusammenleben und ein fruchtbares Zusammenwirken aller Berufsgruppen zu fördern, zum Wohl des ganzen Schweizervolkes und zur Erhaltung unseres lieben Vaterlandes!
Übergang zur SVP
Die BGB und die kantonalen Sektionen der Demokratischen Partei Glarus und Graubünden schlossen sich am 22. September 1971 (Konstituierung: 18. Dezember 1971) zur Schweizerischen Volkspartei zusammen, einerseits um als Partei zu wachsen, andererseits um der drohenden Zersplitterung der rechtskonservativen Kräfte ausserhalb der FDP und CVP entgegenzuwirken. Erst durch diese Vereinigung der stark bernisch geprägten BGB und der Ostschweizer Demokraten wurde die SVP zu einer Partei der gesamten (Deutsch)Schweiz.
Wenn auch die Politik und nicht der Name das Profil einer Partei bestimmen, so kündete die Namensänderung doch den Aufbruch in neue Zeiten an. Waren die ehemaligen BGB-Politiker wie auch die Demokraten ausgesprochene Vertreter von beruflichen Interessengruppen, wie zum Beispiel der Landwirtschaft oder des Gewerbes, so weitete sich der Blick der SVP. Mit dem Begriff „Volkspartei“ hielt die SVP aber auch an den heute tragenden politischen Säulen aus dem Kreise der Landwirtschaft und des Gewerbes fest und bringt damit zum Ausdruck, dass die Arbeitnehmer und weitere Bevölkerungskreise als gleichberechtigte und gleichwertige Kraft den Parteikurs mitbestimmen.
Militär
Rudolf Mingers Wesensart war gekennzeichnet durch eine starke Vaterlandsliebe, verbunden mit der Hingabe an den Wehrdienst. Diese zwei Punkte prädestinierten ihn zum Chef des Eidgenössischen Militärdepartements.
Als der junge Rudolf 1901 in die Rekrutenschule eintrat, war der militärische Aufstieg für einen Bauern keine Selbstverständlichkeit. Jede Arbeitskraft war im Bauernbetrieb unabkömmlich. Die landwirtschaftlichen Maschinen standen erst am Anfang ihrer Entwicklung und fanden in den Bauernbetrieben nur zögernd Eingang. Jede andere Tätigkeit ausser der bäuerlichen erschien als berufsfremd. Die beruflichen und sozialen Aufstiegsmöglichkeiten war für einen Bauern bescheiden. Sie beschränkte sich in der Regel auf die Mitarbeit in den Gemeinden, im Genossenschaftswesen und im Militärdienst. Es ist auffallend zu beobachten, wie viele Bauern aus Mingers Umfeld seinem Weg in die höheren Offiziersränge folgten. Der bäuerliche Nationalrat Jakob Freiburghaus sowie zahlreiche andere bekleideten den Grad eines Obersten.
Für Minger war der Militärdienst eine Ehrensache und zugleich eine Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeit. In der Heimatgemeinde Mülchi stand dem Aufstieg in der Gemeindebehörde sein eigener Vater im Weg. In Schüpfen verwehrten ihm, dem Zugezogenen, Alteingesessene den Zutritt zu einem Amt in der Gemeinde. Ausser seiner Tätigkeit im Genossenschaftswesen bot ihm allein der Waffendienst die erwünschte Aufstiegsmöglichkeit. Seine wegen des Militärdienstes fehlende Arbeitskraft auf dem Hof konnte problemlos durch Verwandte ersetzt werden.
Nach seinem Eintritt in die Rekrutenschule 1901 dauerte diese noch 48 Tage. Er wurde dem Füsilier-Bataillon IV 28 in Bern zugeteilt. Im gleichen Jahr absolvierte er ebenfalls in Bern die 30 Tage dauernde Unteroffiziersschule und wurde am 17. Dezember zum Korporal befördert. Im folgenden Jahr sollte er den erworbenen Grad abverdienen, erkrankte aber an einem Lungenspitzenkatarrh und wurde vom 9. bis 16. April 1902 ins Spital eingewiesen. Obwohl er als geheilt entlassen worden war, riet ihm der Arzt von einem weiteren Militärdienst ab. Doch davon wollte Minger nichts wissen und rückte in die 44 Tage dauernde Aspirantenschule ein. Er erhielt sein Leutnantsbrevier am 17. Dezember 1903. In den folgenden Wiederholungskursen leistete er Dienst im Füsilier-Bataillon II/30 und III/30. Im Jahre 1904 verdiente er in der Rekrutenschule III/I während 55 Tagen den Leutnant ab. Im gleichen Jahr rückte er für 30 Tage in die Schiessschule Nr. V in Walenstadt ein. Ende 1907 erfolgte die Ernennung zum Oberleutnant. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Minger 325 Diensttage geleistet. Zwischen 1908 und 1911 absolvierte er zahlreiche Wiederholungskurse.
Am 31. Dezember 1911 erfolgte seine Beförderung zum Hauptmann.
Besonders eindrücklich waren für ihn die drei Tage Dienst im Jahre 1912 zum Empfang des deutschen Kaiser Willhelms II. in Bern.
Minger war zwischen 1914 und 1918 635 Diensttage im Aktivdienst. 1914 stand er als Kommandant mit dem Füs Kp I/30 im Grenzdienst. 1916 absolvierte er in Bern und Thun die Zentralschule II 1.2 und übernahm die Füs Kp III/30. Am 12. März 1918 wurde er zum Major ernannt.
In der Nachkriegszeit setzte er seine militärische Laufbahn fort, wenn auch mit geringerer Dienstzeit. Er leistete erneut diverse Wiederholungskurse, wobei er 1922 den Generalstabschef Roost kennenlernte. Mit ihm arbeitete er, von Amtes wegen, später als Präsident der Landesverteidigungskommission zusammen.
Am 31. Dezember 1923 erfolgte die Beförderung zum Oberstleutnant. So übernahm er auf den 1. Januar des folgenden Jahres das Kommando des Infanterieregiments 15. Obschon seine Zeit durch die Politik von nun an vermehrt in Anspruch genommen wurde, vernachlässigte Minger seine militärische Weiterbildung keineswegs. So nahm er in den folgenden Jahren an zahlreichen Wiederholungskursen und Schulungen teil.
Ende 1929 wurde er zum Oberst befördert, dies bildete den Abschluss und Höhepunkt von Mingers aktiver militärischer Laufbahn. Zudem wählte ihn gleichzeitig die Vereinigte Bundesversammlung in den Bundesrat. Durch die lange Dienstzeit erwarb Minger fundierte, praktische und theoretische Kenntnisse über das Militärwesen, die ihm als Leiter des Eidgenössischen Militärdepartements sehr zugute kamen.